Fotografie
Technik & Bildgestaltung
Vorwort
Zielgruppe dieses Fotobuchs ist der engagierte Amateur, der auch gerne die Grundlagen der Fotografie kennenlernen möchte. Sie kommen hier etwas ausführlicher zur Sprache als in anderen Anfängerbüchern.
Ich habe mir Mühe gegeben, auch umfangreichere Sachverhalte möglichst einfach und verständlich zu erklären.
Der Schwerpunkt wird trotzdem auf die Praxis und vor allem die Bildgestaltung gesetzt.
Weiterer Dank für Unterstützung mit Informationsmaterial gilt den Firmen Agfa und Kodak.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Einführung
2 Bildwahrnehmung durch den Menschen
3 Grundlagen der Fotografie
3.1 Die Camera obscura (Lochkamera)
3.2 Lichtempfindliche Stoffe
3.3 Die Erfindung der Fotografie
4 Der Film
Schwarzweißfilme
Aufbau des Schwarzweißfilms
4.1.2 Belichtung und Entwicklung
4.1.3 Zusammensetzung des Bildes
Körnigkeit
Die Schwärzungskurve
4.1.6 Farbempfindlichkeit (spektrale Empfindlichkeit)
4.1.7 Lichtempfindlichkeit
4.2 Farbfilme
4.2.1 Farbwahrnehmung des Menschen
4.2.2 Die Farbmischung
4.2.3 Merkmale der Farbe
4.2.4 Aufbau des Farbfilms
4.3 Weitere Eigenschaften der Filme
4.4 Leistungsmerkmale eines Films
4.5 Weitere Spezialfilme
Tips für die Filmauswahl
4.7 Der DX-Code
4.8 Lagerung und Haltbarkeit von Filmen
Abschließende Praxistips
5 Elektronische Bildverarbeitung
5.1 Das Agfa Digital Print System
Besondere Möglichkeiten des Agfa Digital Print System
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Das Auge
Camera obscura
Querschnitt eines Schwarzweißfilms
Belichtung und Entwicklung schematisch
Negativkorn
Schwärzungskurve eines Schwarzweißnegativfilms
Belichtungsspielraum eines Schwarzweißnegativfilms
Spektrale Empfindlichkeit eines SW-Films
Farbmischung
Entstehung der additiven Farbmischung
Entstehung der subtraktiven Farbmischung
Schichtaufbau eines Farbfilms
Bildentstehung beim Farbnegativfilm
Farbdichtekurven
Farbkippen
Absorptionsvermögen der Schichtfarbstoffe
Leistungsdreieck und Leistungspyramide eines Films
DX-Code
Agfa Digital Print System
Einführung
Der eine oder andere Leser wird sich wohl fragen, wozu er ein so umfangreiches Lehrbuch über Fotografie wie dieses lesen soll. Schließlich kann man heute mit vollautomatischen Kameras ohne Vorkenntnisse in den meisten Fällen technisch einwandfreie Fotos zustande bringen. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, daß auch in unserem hochtechnisierten Zeitalter sowie in absehbarer Zukunft gilt: Wenn man gute, aussagekräftige Bilder fotografieren will, muß man sowohl einiges von Fototechnik als auch von Bildgestaltung verstehen. Erst dann ist man in der Lage, das Endergebnis bereits vor der Aufnahme richtig abzuschätzen und zielgerichtet zu beeinflussen.
Fotografiert man beispielsweise eine Schneelandschaft mit einer Automatikkamera und Diafilm, erscheint der Schnee auf den Dias nicht weiß, sondern grau. Jeder erfahrene Fotograf weiß, daß keine Automatik Schnee als solchen erkennen kann und greift deshalb manuell korrigierend ein, indem er reichlicher belichtet, als es der Belichtungsmesser empfiehlt. Die Landschaft wirkt mit einem Teleobjektiv aus größerer Entfernung fotografiert völlig anders als mit einem Weitwinkelobjektiv aus geringerer Entfernung, auch wenn in beiden Fällen die Größe des wichtigsten Bildelements, beispielsweise einer knorrigen Kiefer im Vordergrund, identisch ist. Außer dem richtigen Bildausschnitt und der Perspektive kann dann noch die Beleuchtung darüber entscheiden, ob das Bild hervorragend oder belanglos ist.
Die Beherrschung der Fototechnik ist also eine grundsätzliche Voraussetzung, welche sich der Fotograf auch nach dem momentanen hohen Entwicklungsstand der Technik aneignen sollte, um möglichst gut fotografieren zu können. Die dazu erforderlichen Kenntnisse will der erste Teil dieses Buches vermitteln.
Der zweite Teil geht auf die ebenso wichtige Bildgestaltung ein. Erst eine gute Gestaltung macht Bilder interessant und sehenswert. Auch hier gibt es feste Regeln. Sie beruhen auf Erfahrungen und müssen nicht so genau eingehalten werden wie die der Technik. Schließlich hängt es vom Geschmack des Betrachters ab, ob ihm ein Bild gefällt oder nicht.
Der Zusammenhang zwischen Fototechnik und Bildgestaltung läßt sich durch folgenden Vergleich verdeutlichen: Mit Hilfe des Computers und den entsprechenden Programmen sowie eines Druckers kann man Texte schreiben und zu Papier bringen. Dazu muß man nur wissen, wie das Programm und der Drucker bedient werden. Das Ergebnis ist ein technisch perfekter Ausdruck, Buchstabe für Buchstabe, sauber auf dem Papier. Jeder kann den Text lesen. Das ist vergleichbar mit guter Fototechnik, nämlich dann, wenn das Bild weder zu hell, noch zu dunkel und alles deutlich darauf zu erkennen ist.
Nun hat man bei der Textgestaltung die Auswahl zwischen unterschiedlichen Schriftarten, die dem Text angemessen sind und mit denen er mehr oder weniger gut lesbar ist. Eine Einladung für eine Geburtstagsparty wird man wohl in einer anderen Schriftart schreiben als die Bedienungsanleitung für eine Stereoanlage. Möglicherweise wählt man für die Einladung eine schöne, verschnörkelte Schreibschrift und für die Anleitung eine konventionelle, schnörkelfreie Maschinenschreibschrift. Weiterhin lassen sich die Textabschnitte unterschiedlich anordnen, beispielsweise nebeneinander oder nur untereinander. Hinzu können noch ergänzende und erklärende Abbildungen oder schmückende Attribute kommen, wie etwa ein großer, farbiger Buchstabe am Anfang eines Kapitels. Das ganze nennt sich dann das `Layout' eines Textes. Das Layout kann gut oder schlecht sein und so entweder zum Lesen ermuntern oder davon abschrecken.
Am wichtigsten ist jedoch der Inhalt des Textes. Dieser sollte bei Sachbüchern klar und verständlich, bei Prosatexten künstlerisch wertvoll oder zumindest unterhaltsam sein. Ebenso ist das beim Foto. Ein gutes Layout entspricht einer guten Bildgestaltung. Soll ein Bild jedoch mehr als nur `schön' sein, also auch eine deutliche Botschaft übermitteln oder künstlerische Qualitäten haben, so geht das über konkret erlernbare Techniken hinaus. Hierüber sind nur Andeutungen möglich, keinesfalls feste Regeln.
Wenngleich es kein garantiertes Erfolgsrezept für das Fotografieren gibt, sollen hier, bevor der Lehrteil beginnt, zwei weltbekannte Fotografen zitiert werden. ANDREAS FEININGER (geboren 1906) schreibt dazu: [5]
`Eins steht fest: Der beste Weg, gut fotografieren zu lernen, führt über die Praxis. Über Fotografie zu lesen ist notwendig und empfehlenswert, ebenso das Studieren der Arbeiten bedeutender Fotografen. Aber beides dient nur der Vorbereitung auf die eigene Arbeit.'
ANSEL ADAMS (1902-1984), der beeindruckende Landschaftsaufnahmen in technischer Perfektion hinterlassen hat, schreibt: [4]
`Als ich mich - um 1930 - beruflich der Photographie zuwandte, stellte ich fest, daß die strenge Disziplin, die man mir im Laufe meiner musikalischen Ausbildung anerzogen hatte, sich weitgehend auf meine neue Arbeit übertrug. Ich wage mir kaum vorzustellen, wie meine Photos ohne dieses Beharren auf vorzüglicher Leistung von seiten meiner Musiklehrer ausgesehen hätten.'
In beiden Zitaten ist der Weg zu guten Fotos beschrieben: Zuerst sollte man sich theoretisch Fachwissen durch das Lesen von Fachtexten und Analysieren guter Fotos aneignen. Noch wichtiger ist jedoch die Praxis; nur durch häufiges Üben erwirbt man Routine. Für erfolgreiches Arbeiten ist eine disziplinierte, planvolle Vorgehensweise notwendig. Außerdem sollte man die eigenen Fotos mit strengen Maßstäben bewerten, eventuell begangene Fehler beim nächsten Mal vermeiden und auf stetige Verbesserung aus sein.
Sicherlich ist eine intensivere Beschäftigung mit den technischen und gestalterischen Grundlagen der Fotografie, wie sie in diesem Buch stattfindet, für den Leser zeitaufwendig. Das Buch hat deshalb einen größeren Umfang, weil ich versucht habe, für die Fotografie wichtige physikalische Sachverhalte möglichst verständlich zu erklären. Am Schluß des Buches stehen Formeln mit konkreten Anwendungsbeispielen, die nicht nur für fortgeschrittene Fotografen von Nutzen sein können.
Noch kurz einige Anmerkungen zum Lesen dieses Buches. Wenn an verschiedenen Textstellen auf Abbildungsnummern verwiesen wird und die Abbildung nicht auf der selben oder gegenüberliegenden Seite zu finden ist, können Sie die Seite mit der Abbildung schnell finden, wenn Sie das Abbildungsverzeichnis am Anfang des Buches zur Hilfe nehmen. Die Erklärungen von Fachbegriffen findet man am schnellsten über den Index am Schluß des Buches. Eine Zahl in eckigen
Klammern (z.B. [5]) verweist auf ein Buch, das im Literaturverzeichnis zu finden ist.
Ich bin davon überzeugt, daß der Leser überlegter fotografiert und viel mehr Spaß dabei hat, wenn er über ein fundiertes fotografisches Wissen verfügt. In diesem Sinne wünsche ich viel Freude beim Studieren der nun folgenden Seiten.
2 Bildwahrnehmung durch den Menschen
Bevor nun ausführlich auf die Grundlagen der Fotografie eingegangen wird, soll erst einmal die Bildwahrnehmung des Menschen untersucht werden. Wenn Sie nur das Fotografieren lernen wollen, können Sie gleich mit dem Lesen des nächsten Kapitels über die Grundlagen beginnen und sich dieses Kapitel zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen. Der Grund, warum der menschliche Sehvorgang hier beschrieben wird ist, daß das Sehen immer wieder gerne mit der Fotografie verglichen wird und sich doch völlig von ihr unterscheidet. Das Auge erzeugt zwar ein optisches Bild, aber das ist auch alles, was es mit einer Kamera gemeinsam hat. Abgesehen davon wird das Bild auf andere Weise als mit nur einem Objektiv erzeugt: Nicht alleine die Augenlinse, sondern auch die Hornhaut, das Kammerwasser, die Iris und der Glaskörper wirken bei der Abbildung mit, die nicht in einer Ebene, sondern auf der Netzhaut im kugelförmigen Augapfel stattfindet. Wer sich näher für die eben genannten Fachbegriffe interessiert, findet sie ausführlich in einem Physiologielehrbuch oder guten Universallexikon erklärt. Informationen über den Farbsehvorgang finden Sie im Kapitel `Der Film' unter `Farbwahrnehmung des Menschen'.
Der Mensch nimmt ständig Bilder wahr. So sieht er beispielsweise einen Kreis, von dessen Mittelpunkt zwei Linien ausgehen. Eine davon ist kurz, die andere etwas länger. Dabei erkennt er, daß es sich um eine Uhr handelt. Wie jedoch läuft der menschliche Sehvorgang ab?
Zuerst fällt Licht, eine Form von Strahlungsenergie, auf die Gegenstände unserer Umwelt. Diese reflektieren einen Teil davon in Richtung des Betrachters. Dort trifft das Licht dann unter anderem auf die Augenlinse, die ein Bild der betrachteten Gegenstände auf der Netzhaut erzeugt. Die Netzhaut besteht aus sehr vielen lichtempfindlichen Zellen, die das Licht in neuronale (nervliche) Energie umsetzen. Den Augen ist der Sehnerv angegliedert, der diese `Signale' dann in die hinteren Bereiche des Gehirns, genauer gesagt in die Sehrinde leitet, wo sie von hochspezialisierten Zellen verarbeitet werden. So gibt es Zellen, die Farben unterscheiden, andere wiederum sind für Formen und Bewegung zuständig.
Das Gehirn beinhaltet das sogenannte primäre und das sekundäre Sehzentrum. Im primären Sehzentrum werden die Bilder der Außenwelt in Millionen einzelne Bestandteile zerlegt. Das sekundäre Sehzentrum verwandelt die Strukturen des primären Sehzentrums in komplexe Muster, d.h. in ganze Bilder. Außerdem ist es dafür verantwortlich, daß der Mensch überhaupt identifizieren kann, was er sieht.
Abbildung 2.1 verdeutlicht den Sehvorgang. Sie zeigt auf der linken Seite einen Querschnitt durch das Auge sowie die Abbildung eines Gegenstandes auf der Netzhaut: Der Augenlinse gegenüber befindet sich ein Netzhautbereich, der als `gelber Fleck' bezeichnet wird. In dessen Zentrum ist eine Vertiefung, die sogenannte Fovea centralis. Dort, in der Fovea centralis, sieht der Mensch das Bild am schärfsten.
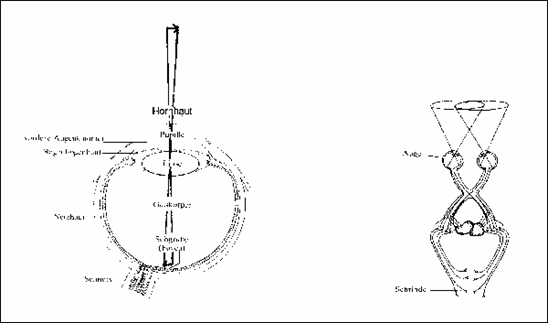
Abbildung 2.1: Das Auge. Links: Das Licht
fällt durch Hornhaut, vordere Augenkammer, Pupille, Linse und Glaskörper auf
die Netzhaut, wo die lichtempfindlichen Rezeptoren gereizt werden. Rechts: Die
Nervenbahnen vom Auge zur Großhirnrinde.
Wird das Hirn im Bereich des Sehzentrums beschädigt, beispielsweise durch einen Unfall oder einen Tumor, kann dies zur Folge haben, daß der Betroffene Teile des Sehfelds nicht mehr wahrnimmt. Statt dessen sieht er dort `Flecken' Oder er kann einzelne Bestandteile der Umwelt nicht mehr zu Bildern zusammenfügen. Wird einer solchen Person dann beispielsweise ein Bild gezeigt, auf dem eine Brille dargestellt ist, sieht er zwei Kreise, einen Querbalken und zwei Stöcke. Der Patient könnte vermuten, daß es sich um ein Fahrrad handle [8].
Auf der rechten Seite von Abbildung 2.1 ist eine Oberansicht des Kopfes zu sehen. Erkennbar ist der Sehnerv, der die Information vom Auge ins Gehirn zum primären Sehzentrum weiterleitet.
Bei einer Schädigung des Gehirns im Bereich des Sehzentrums sind sogar noch schlimmere Folgen zu befürchten. Der Betroffene ist dann unter Umständen unfähig, sich an bestimmte Aspekte der Umwelt zu erinnern, die er vor der Hirnschädigung wahrgenommen hat.
Unsere Augen weisen noch eine bemerkenswerte Besonderheit auf: Entwicklungsbiologisch gesehen ist die Netzhaut Bestandteil des menschlichen Gehirns. Schon dort wird das Bild vorverarbeitet, was einer Belastung unseres Hirns mit überflüssigen Informationen vorbeugt.
Fassen wir den Sehvorgang noch einmal kurz zusammen: Irgendeine Lichtquelle, sei es die Sonne oder eine Glühbirne, bestrahlt einen Gegenstand. Das vom Gegenstand reflektierte Licht wird in den Augen als Bild auf die Netzhaut projiziert. Im Licht selbst steckt Energie, die von den Netzhautzellen in nervliche Energie umgewandelt und als Information zum Gehirn weitergeleitet wird. Dort vollzieht sich die vollständige Erkennung des Bildes. Wesentliches Merkmal des Bildsehens ist daß das Gehirn die Bilder nicht von der Augennetzhaut abliest wie etwa von einer Leinwand. Es rekonstruiert vielmehr diese Bilder selbständig.
Für den Fotografen ist ein Unterschied zwischen dem von der Kamera erzeugten Bild und dem `Bild', das er sieht von besonderer Bedeutung: Der Mensch wählt aus, was er sehen will und konzentriert sich darauf. Dinge, die ihm uninteressant erscheinen, nimmt er nicht oder nur nebenbei wahr. Das Foto hingegen zeigt alle Gegenstände deutlich, die in der Bildschärfe liegen, selbst wenn sie nicht von Interesse sind.
Das bedeutet: Nehmen wir an, Sie befinden sich in einer Stadt und sehen dort ein schönes Gebäude, das Ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vor dem Gebäude steht eine gräßliche Mülltonne. Auch wenn das Auge die Mülltonne auf die Netzhaut projiziert, nehmen Sie diese nicht wahr, solange Sie sich nur für das Gebäude interessieren.
Gerade darin besteht ein häufiger Anfängerfehler: Auch durch die Kamera sehen unerfahrene Fotografen nur das, was sie am Motiv interessiert. Die Kamera aber registriert alles. Später ist dann das Bildergebnis oft enttäuschend, weil zuviel Nebensächliches auf dem Foto zu sehen ist. Um beim Beispiel des Gebäudes zu bleiben: Die gräßliche Mülltonne könnte Ihnen das ganze Bild verderben. Vielleicht ist es ja möglich, sie für die Dauer der Aufnahme beiseite zu schieben.
Es gibt noch drei weitere wichtige `technische' Unterschiede zwischen dem menschlichen Sehen und der Fotografie, die der Fotograf kennen sollte:
Die Farbwahrnehmung des Menschen und die Farbwiedergabe durch den Film
Den Helligkeitsunterschied, welchen Mensch und Film überbrücken können
Die Lichtverhältnisse, unter denen Mensch und Film noch gut sehen. Mit: `Der Film sieht noch gut', meine ich, daß man noch aus freier Hand fotografieren kann, ohne Blitz und Stativ bemühen zu müssen.
Diese Unterschiede werden in den Kapiteln Film und Belichtungsmessung ausführlicher besprochen. Hier sollen nur drei typische Beispiele genannt werden, wie sich die Unterschiede im einzelnen auswirken können. In allen Fällen muß der Fotograf bereits vor der Aufnahme wissen, wie ungefähr das spätere Bild aussehen wird und eventuell korrigierend eingreifen.
Wenn ein weißes Blatt Papier mit einer Glühbirne beleuchtet wird, erscheint es dem Menschen immer noch weiß. Der Film hingegen sieht es rötlich.
Für den Menschen ist es kein großes Problem, sowohl eine Szene im Schatten als auch im hellen Sonnenlicht gleichzeitig zu betrachten. Der Film gibt entweder alles was im Schatten ist als schwarze Fläche wieder oder den hellen Motivteil als weiße Fläche. Entweder ist dann im Schatten oder im hellen Bereich nichts mehr vom Motiv zu erkennen.
Selbst wenn wenig Licht vorhanden ist, sieht der Mensch noch recht gut. Ein mit `hellen' Neonröhren beleuchtetes Zimmer empfindet er als hell. Auch an stark bewölkten Tagen oder im dunklen Schatten nimmt er die Umgebung noch als hell wahr. Wenn man fotografiert, kann es bei solchen Lichtverhältnissen erforderlich sein, ein Blitzlicht oder lichtempfindliche Filme einzusetzen. Oder man muß vom Stativ aus fotografieren, damit die Bilder scharf und nicht verwackelt werden.
3 Grundlagen der Fotografie
Das Wort Photographie, eingedeutscht Fotografie, eine Zusammensetzung der griechischen Wörter phos `Licht' und gráphein `schreiben', `aufzeichnen'. Fotografieren bedeutet demnach im übertragenen Sinne `Lichtbilder herstellen'.
Neben Licht benötigt man zum Fotografieren noch einen Apparat, der Bilder erzeugt und ein lichtempfindliches Material, das sie festhält. Während die Suche nach lichtempfindlichen Stoffen erst vor etwa 200 Jahren erfolgreich war, kannte man schon seit mehr als einem Jahrtausend einen bilderzeugenden Apparat: Die Camera obscura.
3.1 Die Camera obscura (Lochkamera)
3.2 Lichtempfindliche Stoffe
3.3 Die Erfindung der Fotografie
3.1 Die Camera obscura (Lochkamera)
Vor mehr als zweitausend Jahren entdeckte der berühmte griechische Philosoph ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) während einer Sonnenfinsternis in einem Baumschatten das mehrfache Abbild der Sonne. Er folgerte, daß es durch die Lücken, durch kleine `Löcher' im Blattwerk des Baumes gebildet wurde. Diese Erkenntnis ist der Nachwelt überliefert.
Allgemein läßt sich aus der Beobachtung von Aristoteles ableiten: Wenn Licht durch eine kleine Öffnung in einen dunklen Raum fällt, wird auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite ein Bild des Gegenstandes erzeugt, von dem das Licht ausgeht.
Findige Bastler machten sich das zunutze: Sie bauten einen Kasten, der innen ganz dunkel war. Daher kommt auch der Name Camera obscura zu deutsch `dunkle Kammer' auch Lochkamera genannt. In diesen Kasten bohrten sie ein kleines Loch und brachten auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite eine transparente Rückwand an. Auf dieser wird ein kopfstehendes, seitenverkehrtes Bild der Umwelt projiziert. Abbildung 3.1 zeigt das Prinzip einer Camera obscura.
Die Rückwand muß halbtransparent sein wie ein Butterbrotpapier oder eine Mattglasscheibe, wenn man das Bild außerhalb der Lochkamera betrachten will. Kann man jedoch in die Camera obscura selbst schauen oder hineingehen, was bei entsprechender Größe der Kamera möglich ist, so kann die Rückwand undurchsichtig sein. Dabei wird das Bild auf eine weiße Leinwand projiziert. Um 1700 gab es ganze Häuser, die extra für Touristen zu Camera obscura umfunktioniert wurden. Wer sich dafür interessierte, konnte gegen Eintrittsgeld im Haus die angrenzende außenliegende Umgebung beobachten.
Die erste Beschreibung einer Lochkamera stammt vom arabischen Naturforscher IBN AL HAITHAM (965-um1040) . Auch LEONARDO DA VINCI (1452-1519) hat die Camera obscura im 15. Jahrhundert beschrieben.
Weil das Loch sehr klein sein muß, damit die Abbildung scharf erscheint, ist das Bild ziemlich dunkel. Deshalb wurde die Camera obscura schon bald verbessert. An Stelle des Loches wurde eine Sammellinse verwendet. Das Bild wird dadurch heller und schärfer. Diese Verbesserung der Lochkamera ist erstmals von HIERONYMUS CARDANUS (1501-1576) erwähnt worden.
Abbildung 3.1: Camera obscura. Die Camera obscura erzeugt kopfstehende, seitenverkehrte Bilder. Die Mechanismus der Bildentstehung ist, daß durch das kleine Loch von jeden Gegenstandspunkt nur wenige Lichtstrahlen gelangen. Diese hinterlassen einen Lichtfleck auf der Kamerarückwand, der als `Bildpunkt' bezeichnet wird.
Die Camera obscura wurde bis ins 19. Jahrhundert als Mal- und Zeichengerät benutzt. Dabei mußte das auf eine Leinwand projizierte Bild mit Pinsel oder Stift nachgezeichnet werden. Außerdem ist die Lochkamera der Prototyp jedes Fotoapparates. Selbst die modernsten, mit Computer ausgestatteten Kameras sind im Prinzip nichts anderes als Camera obscura mit einer Linse. Die Kammer wird Kameragehäuse, die Linse Objektiv eines Fotoapparates genannt. Das Objektiv besteht jedoch aus zwei oder mehr Linsen, um eine noch schärfere Abbildung zu erhalten.
3.2 Lichtempfindliche Stoffe
Die Camera obscura wurde nachweisbar spätestens seit dem 17. Jahrhundert zur Erzeugung von Bildvorlagen verwendet. Die damit projizierten Bilder mußten von Hand nachgezeichnet werden und dienten als Vorlagen für Zeichnungen und Gemälde. Es sollte noch eine Weile dauern, bis Stoffe gefunden wurden, die das Bild von selbst festhielten.
Weil das Bild der Lochkamera durch Licht entsteht, müssen dies Materialien sein, welche auf Licht reagieren. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts entdeckten einige Forscher lichtempfindliche Stoffe, beispielsweise Asphalt, Harze, Silbernitrat, Silberchlorid und Silberbromid, die sich unter Lichteinwirkung verändern. Flüssiger Asphalt verfestigt sich und silberhaltige Stoffe werden durch die Energie des Lichtes schwarz. Im folgenden Kapitel `Filme' wird darauf etwas ausführlicher eingegangen.
Bereits um 1800 wurden erfolgreich Versuche mit silberhaltigen Materialien durchgeführt, um damit Lichtbilder herzustellen. Dort wo Licht hinfällt, ist das Bild schwarz. Stellen, die kein Licht erhalten, bleiben hell. Das Problem bestand darin, daß zwar ein Bild entstand, dieses jedoch nicht haltbar war. Denn um ein Bild zu betrachten, benötigte man logischerweise wiederum Licht. Und das Licht, welches man zum Anschauen der Bilder verwendete, zerstörte diese, indem es die nicht schwarzen Stellen schwärzte. Das Resultat war eine gleichmäßig schwarze Fläche.
Es wurde daher nach einem Mittel gesucht, welches aus den hellen Stellen das Silber entfernte, so daß sie bei erneutem Lichteinfall nicht mehr dunkel wurden. Das Mittel fand man erst viel später, um 1840. Einen Stoff, der aus den silberhaltigen Bildplatten nicht schwarze, vollständig in reines Silber umgewandelte Silberverbindungen entfernt, nennt man Fixiermittel . Erst durch die Fixage wird das Foto dauerhaft haltbar.
3.3 Die Erfindung der Fotografie
Die Fotografie wurde nicht von einer einzelnen Person erfunden. Anfang des 19. Jahrhunderts experimentierten mehrere Forscher mit der Herstellung von Lichtbildern.
Die Erfindung der Fotografie wird drei Personen zugeschrieben: NICfEPHORE NIfEPCE (1765-1833) , LOUIS JACQUES MANDfE DAGUERRE (1787-1851) und WILLIAM HENRY FOX TALBOT (1800-1877) .
Die älteste Fotografie der Welt fertigte NICfEPHORE NIfEPCE an. Sie zeigt den Hof seines Guts von seinem Arbeitszimmer aus. Vermutlich verwendete NIfEPCE für diese Aufnahme eine Camera obscura. Der Franzose strich eine dünne Schicht flüssigen Asphalts auf Metallplatten, nachdem er schlechte Erfahrungen mit den leicht zerbrechlichen Glasplatten gemacht hatte. Bildstellen, die belichtet werden, festigen den Asphalt, dunkle Bereiche bleiben feucht. Die feuchten Stellen wusch NIfEPCE mit einer Mischung aus Lavendelöl und Terpentin aus. Das Bildergebnis ist ein Negativ des fotografierten Gegenstands: Helle Motivstellen erscheinen dunkel und dunkle hell. Das heute noch erhaltene älteste Foto der Welt hat eine Größe von 16,5 x 20,5 Zentimetern. Die Aufnahmezeit betrug dabei mindestens acht Stunden.
LOUIS JACQUES MANDfE DAGUERRE schloß 1829 mit NIfEPCE einen Partnerschaftsvertrag ab. NIfEPCE weihte DAGUERRE in sein Verfahren ein, der es verbesserte, indem er Kupferplatten hauchdünn mit Silber beschichtete und sie mit Joddämpfen lichtempfindlich machte. Dann befestigte DAGUERRE die Platten an der Kamerarückwand, belichtete sie und machte das Bild mit Quecksilberdämpfen sichtbar. Das Sichtbarmachen eines Bildes wird mit Entwicklung bezeichnet. Vor der Entwicklung ist das Bild unsichtbar. In der Fachsprache heißen unsichtbare, noch nicht entwickelte Bilder latent. Auf diese Weise kann man wesentlich kürzere Belichtungszeiten erreichen als durch langes Warten darauf, bis die Platten endlich geschwärzt sind. Abschließend wurde das Bild in warmer Kochsalzlösung haltbar gemacht, also fixiert. Die so erzeugten Fotos nannte DAGUERRE Daguerreotypien.
Am 19. August 1839 wurde das Verfahren von der Pariser Akademie der Wissenschaft veröffentlicht. Dieses Datum gilt als der Geburtstag der Fotografie. Entgegen seines Partnerschaftsvertrages mit NIfEPCE gab DAGUERRE sich als maßgeblicher Erfinder der Fotografie aus.
Sowohl die Bilder von NIEPCE als auch die des Herrn DAGUERRE haben einen entscheidenden Nachteil: Man kann sie nicht vervielfältigen, es handelt sich um Unikate, die nach Verlust oder Zerstörung nicht wieder ersetzt werden können.
Im Gegensatz dazu entwickelte der Engländer WILLIAM HENRY FOX TALBOT ein Verfahren, das Vervielfältigungen erlaubt. Er tauchte feines Schreibpapier in eine schwach konzentrierte Kochsalzlösung, wischte es trocken und bestrich es anschließend mit Silbernitrat. Nach erneutem Trocknen konnte das Papier belichtet werden. Die Fixierung geschah mittels einer Kochsalzlösung. TALBOT nannte diese Bilder Photogenic drawings (Lichterzeichnungen). Das älteste heute noch erhaltene so entstandene Foto nahm der Mathematiker 1835 auf seinen Landsitz auf. Es zeigt das Fenster seiner Bibliothek.
Im Laufe der Jahre verbesserte TALBOT sein Verfahren und nannte es nach der Vervollkommnung Kalotypie: Ein feines Schreibpapier wurde zuerst mit Silbernitrat, dann mit Jodkalium behandelt, woraus eine Jodsilberschicht entstand. Kurz vor der Belichtung wurde das Papier mit Gallosilbernitrat bestrichen, das ist eine Lösung aus Gallussäure, Silbernitrat und Essig. Während der Belichtung, deren Dauer bei Sonnenschein etwa eine Minute betrug, entstand ein unsichtbares, latentes, Bild. Das Papier wurde anschließend erneut mit Gallosilbernitrat bestrichen und dadurch sichtbar gemacht. Schließlich wurde das Bild durch eine Kaliumbromid- oder Fixiernatronlösung mit abschließender Wässerung haltbar gemacht. Bei der Wässerung wird das Bild oder der Film in Wasser gebadet oder für längere Zeit damit übergossen, um restliche Entwickler- und Fixierchemikalien zu entfernen. Die Kalotypie wird zu Ehren des Erfinders auch Talbotypie genannt.
Wenn man eine Kalotypie auf ein weiteres lichtempfindliches Blatt Papier legt, kann man das Bild durch Lichteinstrahlung auf das unbelichtete Papier übertragen und auf diese Weise beliebig viele Kopien herstellen. Die sogenannten Kontaktkopien (`Kontakt', weil beide Papiere direkt aufeinanderliegen) sind Positive, die das Motiv in seiner richtigen Helligkeit zeigen.
Die eben genannten Erfinder leisteten die wichtigsten Pionierarbeiten, die das heutige fotografische Verfahren ausmachen: Es muß nicht lange gewartet werden, bis Licht die Silberschicht schwärzt. Dadurch erreicht man kurze Belichtungszeiten. Durch die Entwicklung wird das Bild sichtbar und durch das Fixieren haltbar gemacht. Dabei erhält man ein Negativ, dessen Helligkeit genau umgekehrt zum Motiv ist. Das Negativ wird erneut auf eine Silberschicht umkopiert und somit zum Positiv, welches das Motiv in richtigen Helligkeitswerten zeigt. Vom Negativ lassen sich beliebig viele Abzüge herstellen.
Auch wenn heute moderne Fotoapparate und Objektive von Mikrocomputern gesteuert werden und Bilder in hohem Maße durch Personalcomputer verändert werden können, so ist und bleiben die Grundlagen der Fotografie dieselben: Ein Apparat erzeugt mit Hilfe des Lichts Bilder, die durch lichtempfindliche Stoffe festgehalten werden. Der Apparat ist ein Kameragehäuse mit Objektiv, die lichtempfindlichen Stoffe befinden sich auf dem Film oder bei elektronischer Bildaufzeichnung auf einen Mikrochip. Wer die physikalischen und chemischen Grundlagen der Fotografie einmal kennt, wird auch zukünftige Technologien relativ schnell verstehen und beurteilen können.
4 Der Film
Der Film hält das von der Kamera erzeugte Bild dauerhaft fest. Seine Eigenschaften bestimmen maßgeblich, wie es nach Aufnahme und Entwicklung erscheint. Der Fotograf muß die Belichtung und Filterung genau auf den Film abstimmen, also dessen Eigenschaften gut kennen. Dieses Kapitel geht daher etwas ausführlicher auf den Film ein.
Schwarzweißfilme
Aufbau des Schwarzweißfilms
4.1.2 Belichtung und Entwicklung
4.1.3 Zusammensetzung des Bildes
Körnigkeit
Die Schwärzungskurve
4.1.6 Farbempfindlichkeit (spektrale Empfindlichkeit)
4.1.7 Lichtempfindlichkeit
4.2 Farbfilme
4.2.1 Farbwahrnehmung des Menschen
4.2.2 Die Farbmischung
4.2.3 Merkmale der Farbe
4.2.4 Aufbau des Farbfilms
4.3 Weitere Eigenschaften der Filme
4.4 Leistungsmerkmale eines Films
4.5 Weitere Spezialfilme
Tips für die Filmauswahl
4.7 Der DX-Code
4.8 Lagerung und Haltbarkeit von Filmen
Abschließende Praxistips
Schwarzweißfilme
Schwarzweißfilme bilden Gegenstände farblos ab. Die Aufnahmen erscheinen vom tiefen Schwarz über mehrere Grautöne bis zu lichtem Weiß. Die ersten Filme in der Geschichte der Fotografie waren schwarzweiß. Es sollten noch etwa 50 Jahre vergehen, bis die ersten Farbfotos entstanden und gar ein Jahrhundert bis zur Entwicklung eines Farbfilms auf gleicher Basis wie heute.
Obwohl die Welt farbig ist und jedermann recht einfach Farbfotos schießen kann, gibt es auch heute für den Hobbyfotografen gute Gründe, schwarzweiß zu fotografieren: Wenn Struktur, Muster oder Form wesentliche Eigenschaften eines Motivs sind, ist der Schwarzweißfilm erste Wahl. Schärfe und Haltbarkeit sind besser als beim Farbfilm, Entwicklung und Vergrößerung einfacher und kostengünstiger.
Der Farbfilm unterscheidet sich im Aufbau kaum vom Schwarzweißfilm. Wer das Funktionsprinzip von Schwarzweißfilmen versteht, wird sich auch rasch mit den etwas komplizierteren Farbfilmen zurechtfinden. Aus diesem Grunde werden hier zuerst die Eigenschaften von Schwarzweißfilmen beschrieben.
Aufbau des Schwarzweißfilms
Jeder fotografische Film besteht aus einer lichtempfindlichen Schicht und einem Material, das diese trägt. Das Bild entsteht auf der lichtempfindlichen Schicht und setzt sich aus Silber zusammen.
Während TALBOT Papier als Trägermaterial verwendete, setzte DAGUERRE Kupferplatten ein (s. Grundlagen, Erfindung der Fotografie). Papierbilder sind jedoch schlecht zu kopieren, und von Kupferplatten läßt sich überhaupt keine Kopie anfertigen; jedes Bild ist ein Einzelstück. Um Bilder vergrößern und vervielfältigen zu können, wird die lichtempfindliche Schicht auf durchsichtige Unterlagen aufgetragen. Dadurch wird das Bild transparent und kann bei Durchleuchtung auf Fotopapier projiziert werden. Heute verwendet man als Schichtträger Kunststoffe, beispielsweise Acetylzellulose oder Polycarbonate. Ihre Dicke beträgt etwa ein Zehntel Millimeter.
Das Silber, aus dem das Bild besteht, wird durch Lichteinwirkung auf Silberhalogenide erzeugt, die sich im Film befinden. Silberhalogenide sind Verbindungen aus Silber und den Halogenen Brom, Chlor oder Jod. Um die Halogenide an den Schichtträger zu binden und gleichmäßig zu verteilen, bettet man sie in Gelatine ein. Die Gelatine wird aus Säugetierknochen und -häuten gewonnen. Außerdem werden ihr noch chemische Stoffe zugesetzt, z.B. Gold- und Schwefelverbindungen.
Die Gelatine ist nicht nur Einbettungsmaterial, sondern wirkt unterstützend bei der Belichtung und Entwicklung des Bildes mit. Sie konnte bislang durch keinen künstlichen Stoff ersetzt werden. Dies ist bedauerlich, denn Gelatine begrenzt die Lebensdauer der Filme, weil Bakterien in ihr einen guten Nährboden finden. Um `Bakterienfraß' zu vermeiden, sollte man Filme weder feucht noch warm lagern.
Die lichtempfindliche Schicht wird als Emulsion bezeichnet und ist etwa 10/1000 bis 15/1000 mm dick. In ihr sind die Silberhalogenide auf etwa 20 Schichten verteilt. Allerdings ist die Bezeichnung Emulsion, die sich durchgesetzt hat, nicht ganz richtig, denn in einer Emulsion ist eine Flüssigkeit in Form feiner Tröpfchen in einer nicht mit ihr mischbaren anderen Flüssigkeit verteilt . Beim Film handelt es sich vielmehr um eine Suspension, einer Mischung aus festen und flüssigen Bestandteilen.
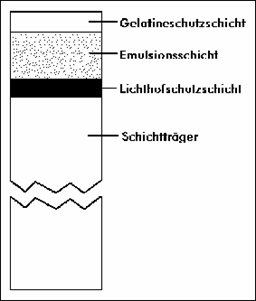 Der Film besitzt noch eine
Lichthofschutz- sowie Gelatineschutzschicht. Die Lichthofschutzschicht
befindet sich direkt auf der Unterlage, dem Schichtträger, und verhindert
unerwünschte Lichtreflexionen durch das Trägermaterial. Der Schichtträger würde
ansonsten das Licht so reflektieren, daß es sich deutlich als Hof, das ist ein
Lichtsaum, um helle
Der Film besitzt noch eine
Lichthofschutz- sowie Gelatineschutzschicht. Die Lichthofschutzschicht
befindet sich direkt auf der Unterlage, dem Schichtträger, und verhindert
unerwünschte Lichtreflexionen durch das Trägermaterial. Der Schichtträger würde
ansonsten das Licht so reflektieren, daß es sich deutlich als Hof, das ist ein
Lichtsaum, um helle
Punkte in dunkler Umgebung bemerkbar macht, z.B. um Lichtquellen.
Abbildung: Querschnitt eines Schwarzweißfilms. Der Schichtträger besteht aus durchsichtigen Kunststoff und ist ca. 0,1 mm dick. Die Emulsionsschicht enthält die in Gelatine eingebetteten lichtempfindlichen Silberhalogenide und ist 10/1000 bis 15/1000 mm dick.
Wenn ein Hof durch Lichtreflexion des Schichtträgers verursacht wird, bezeichnet man ihn als Reflexionslichthof. Der Lichthofschutz ist als dunkle Lackschicht auf dem Kleinbildfilm vor der Entwicklung zu erkennen. Während der Entwicklung wird sie durch den Entwickler entfernt. Die Gelatineschutzschicht ( Blitzschutzschicht) befindet sich auf der Oberfläche der Emulsion und schützt diese gegen mechanische Beschädigung. Außerdem setzt sie den Oberflächenwiderstand des Films herab. So werden unerwünschte statische Aufladungen beim Filmtransport in der Kamera vermieden, die zu Spuren auf der Filmschicht führen können. Man spricht in diesem Fall vom `Verblitzen' des Films.
4.1.2 Belichtung und Entwicklung
Durch Belichtung und Entwicklung werden die Silberhalogenide Silberbromid, Silberchlorid und Silberjodid zerlegt. Dabei entsteht reines Silber, welches das Bild aufbaut. Die Halogene Brom, Chlor und Jod gehen zum geringen Teil bei der Belichtung in die Luft und in die Gelatine über oder werden größtenteils bei der Entwicklung ausgespült.
Außer der chemisch-physikalischen Zusammensetzung des Films bestimmen Belichtung und Entwicklung die Filmeigenschaften. Das heißt, mit dem Erwerb eines Films sind dessen Eigenschaften nicht endgültig bestimmt. Belichtungszeit und Objektivblende, chemische Zusammensetzung des Entwicklers und Vorgehensweise bei der Entwicklung erst bestimmen die endgültigen Eigenschaften eines Film, wie sie im folgenden besprochen werden. Deshalb gelten Angaben seitens der Filmhersteller immer für einen standardisierten Belichtungs- und Entwicklungsprozeß.
In der Praxis heißt das: Wenn man den Film gemäß der angegebenen Lichtempfindlichkeit belichtet und in einem Standardentwickler in einem standardisierten Verfahren entwickelt (bestimmte Entwicklertemperatur und Filmbewegung in der Entwicklerflüssigkeit für eine genau definierte Zeitdauer), dann hat er die zugesprochenen Eigenschaften.
Zum Zwecke des Experimentierens oder aus Notwendigkeit kann der Fotograf einen der Faktoren Belichtung und Entwicklung gezielt ändern. Notwendig kann das sein, wenn man z.B. bei schlechteren Lichtverhältnissen mit einen geringer lichtempfindlichen Film dennoch fotografieren will oder wenn das Motiv große Helligkeitsunterschiede aufweist, die der Film bei einer Standardentwicklung nicht bewältigen kann.
Wenn man volle Kontrolle über das Bildergebnis haben will, muß man seine Filme selbst entwickeln. Kommerzielle Labors entwickeln nur nach einen Standardverfahren. Ausnahme: Die Veränderung der Filmempfindlichkeit bieten die meisten Labors an. Wozu das ganze gut ist, steht gegen Ende dieses Kapitels.
Wie entsteht das Bild? Zuerst trifft Licht auf den Film und dort auf die Silberhalogenide. Ein Silberhalogenidkristall ist etwa 0,2/1000 bis 2/1000 mm groß. Er besteht aus ca. 20 Milliarden Silberionen und ebenso vielen Halogenidionen. Durch eine Reaktion des Lichts mit dem Kristall werden einige Silberionen von den Halogenidionen getrennt. Dabei entstehen elementare (reine) Halogene und metallisches Silber.
An den Stellen, die viel Licht erhalten, dringt das Licht in tiefere Schichten vor und es entsteht mehr Silber als an Stellen, die von weniger Licht getroffen werden. Dadurch werden Schwarz, Weiß und unterschiedliche Graustufen gebildet. An schwarzen Stellen sind sämtliche Halogenide in Silber umgewandelt, graue Stellen enthalten je nach Intensität mehr oder weniger Silber und bei weißen Negativstellen ist praktisch kein elementares Silber vorhanden. Infolge seiner sehr feinen Verteilung erscheint das Silber nicht silbern, wie man vermuten könnte, sondern schwarz.
Es reicht aus, wenn bei der Belichtung von den mehr als 20 Milliarden Silberhalogeniden 4 bis 10 Silberatome pro Kristall gebildet werden. Der Kristall ist dann ein Entwicklungskeim, an dem der Filmentwickler seine Wirkung entfalten kann. Die restlichen der 20 Milliarden Silberhalogenide des Kristalls werden erst durch die Entwicklung in reines Silber umgewandelt. Damit verstärkt die Entwicklung den Belichtungseindruck um das Milliardenfache, wodurch sehr kurze Belichtungszeiten ermöglicht werden. Die Halogenanteile Brom, Chlor oder Jod gehen in den Entwickler über, und der Kristall besteht nur noch aus Silber. Ein vollständig in Silber umgewandelter Kristall wird als Korn bezeichnet. Eine nähere Beschreibung des Korns und der Körnigkeit erfolgt im Anschluß an diesen Abschnitt.
Man kann einen belichteten Film nicht von einen unbelichteten unterscheiden. Nach der Belichtung ist das Bild latent (verborgen) und wird erst durch die Entwicklung sichtbar. Wenn man also der Kamera den Film entnimmt, um nachzusehen, was sich nach der Belichtung ergeben hat, würde man keine Veränderung bemerken. Die Aufnahmen sind dann allerdings verdorben.
Die Entwicklung, also die vollständige Umwandlung der Belichtungskeime in Silber, erfolgt mit Hilfe des Entwicklers, einer Flüssigkeit mit chemischen Wirksubstanzen. Um das so entstandene Bild haltbar zu machen, muß es anschließend fixiert werden, was ebenfalls in einem Flüssigkeitsbad, dem Fixierbad, erfolgt. Das Fixierbad entfernt alle nicht vollständig in Silber umgewandelten Silberhalogenide.
Die Hell-Dunkel-Verteilung des Filmbildes hängt von der Helligkeitsverteilung des Motivs ab: Helle Motivstellen reflektieren viel Licht. Viel Licht erzeugt viele Silberkörner auf dem Film, weil es in tiefe Schichten vordringt und stärker auf Nachbarkristalle reflektiert wird. Dort ist der Film dann weniger durchsichtig, weil viele Silberkörner wenig Licht hindurchlassen und auch wenig reflektieren, da sie schwarz sind. Infolgedessen erscheint der Film dort dunkel. Von dunklen Motivstellen geht wenig Licht aus, das auch nur wenige Silberkörner auf dem Film erzeugt. Dort ist der Film dann durchsichtiger und heller. Weil helle Motivstellen auf dem Film dunkel erscheinen und dunkle hell, entsteht ein Negativ des Motivs.
Anschließend wird das Negativ auf Fotopapier vergrößert, das ähnlich wie der Film aufgebaut ist und ebenso auf Licht reagiert. Der Unterschied zum Film besteht darin, daß die Emulsion mit den Silberhalogeniden sich nicht auf durchsichtigem Kunststoff, sondern auf einen undurchsichtigen, dünnen Karton befindet. Der Vergrößerer funktioniert wie ein Diaprojektor, indem er ein vergrößertes Bild des Negativs auf das Fotopapier projiziert. Dabei lassen dunkle Negativstellen wenig Vergrößererlicht hindurch, schwärzen das Fotopapier nur gering und erscheinen nach der Entwicklung des Papiers darauf hell. Bei hellen Negativstellen ist das genau umgekehrt.
Der Papierabzug ist somit ein Negativ des Negativs, weist also die umgekehrte Helligkeit wie dieses auf. Das Resultat ist ein Positiv, welches das Motiv wieder in seiner richtigen Helligkeit zeigt. Im Gegensatz zum Negativfilm bildet der Umkehrfilm die Motivhelligkeit richtig ab. Praktisch jeder Schwarzweißnegativfilm kann durch entsprechende Entwicklung zum Diafilm werden.
Dazu wird der Negativfilm zuerst entwickelt und anschließend das Silberbild durch Ausbleichen entfernt. Nun sind auf dem Film die nicht entwickelten Silberhalogenide verblieben. Diese werden nachbelichtet, beispielsweise mit einer Glühbirne, und anschließend entwickelt. Das so erzielte Silberbild ist ein Positiv.
Abbildung 4.2: Belichtung und Entwicklung schematisch.
Dargestellt ist ein Silberhalogenidkristall (zweidimensional) mit einzelnen
Silberionen (Ag) und Halogenidionen (X). `Ag' ist das chemische Zeichen für
Silber, `X' steht für ein Halogenid, z.B. Bromid. Man spricht daher auch
allgemein von AgX-Kristallen. `+' und `-' kennzeichnen den Ladezustand der
Ionen (positiv oder negativ). 1)+2) Das Licht trennt einige Halogenidionen
von den Silberionen, indem es den Halogenidionen ein Elektron `entreißt'. Dabei
entstehen Halogenmoleküle (gepunktete Kreise), die verlorengehen, z.B. in die
Luft und Silberatome, d.h. metallisches Silber (schwarze Kreise), indem sich
das Elektron an das Silberion `heftet'. 3)+4) Der Entwickler wandelt alle
Silberhalogenidmoleküle in einem AgX-Kristall in reines Silber um. Bereits
belichtete Kristalle werden mit erheblicher Beschleunigung gegenüber
unbelichteten Kristallen entwickelt. In einem Kristall befinden sich etwa 20
Milliarden Silberhalogenide. Es reicht bereits aus, wenn das Licht davon
lediglich 4 bis 10 Halogenide zu Silber reduziert, um die beschleunigte
Entwicklung zu erzielen.
Wer gerne Schwarzweißdias fotografieren möchte, aber wem die Selbstentwicklung zu umständlich ist, findet auf dem Markt auch einen Schwarzweißdiafilm, der über ein Labor entwickelt wird, nämlich den Agfa Scala. Abbildung 4.2 zeigt noch einmal schematisch den Belichtungs- und Entwicklungsvorgang anhand eines Korns.
4.1.3 Zusammensetzung des Bildes
Beim Schwarzweißfoto bauen zahlreiche Silberkörner das Bild ähnlich wie Mosaiksteine auf. Ein einzelnes Silberbromidkristall mißt lediglich 0,2/1000 bis 2/1000 mm. Deshalb können auf einer verhältnismäßig kleinen Filmfläche sehr detailreiche Bilder entstehen.
Beim Kleinbildfilm mit seiner Fläche von 24x36 mm können rein theoretisch mehr als 80 Millionen Silberkörner ein Bild aufbauen, wenn ein einzelnes Korn einen Durchmesser von 1/1000 mm hat. Nun verteilt sich das Silber auf etwa 20 Schichten, so daß sich Körner aus unterschiedlichen Schichten überlappen. Auch in der gleichen Schicht ist es möglich, daß sich einzelne Körner zusammenballen. Das Korn, bzw. der Bildpunkt, ist also eine Überlappungsfigur aus mehreren Silberkörnern, die größer als ein einzelner Silberkristall ist.
Deshalb stehen zwar weniger als die theoretisch möglichen 80 Millionen Bildpunkte zur Verfügung, aber immer noch so viele, auf jeden Fall mehrere Millionen, so daß der Film ein `Datenträger' mit höchster Informationsdichte ist.
Körnigkeit
Die Körnigkeit ist im Gegensatz zum Korn eine subjektive Empfindung. Sie entsteht beim Betrachten homogener Flächen, das sind Flächen gleicher Helligkeit, des Papierbildes oder Dias. Die Körnigkeit äußert sich als Eindruck einer Ungleichmäßigkeit, `Zerrissenheit' von Bildflächen. Sie wächst mit stärkerer Vergrößerung und tritt am deutlichsten bei mittelhellen Bildstellen auf.
Wer ein Negativ oder Dia unter dem Mikroskop betrachtet, kann die Ursache der Körnigkeit feststellen: Weil unterschiedlich helle Flächen durch eine verschiedene Anzahl von Körnern gebildet werden, entsteht ein `Hell-Dunkel-Lückenmuster'. Es setzt sich aus undurchsichtigen, mit Silberkörnern bedeckten und aus durchsichtigen, unbedeckten Stellen zusammen. Die Körnigkeit entsteht nicht durch die Silberkörner, sondern durch unbedeckte, durchsichtige, lochförmige Filmstellen.
Bei mittelhellen Negativstellen hat das Lückenmuster die meisten Löcher d.h. durchsichtige Stellen, so daß dort auch der stärkste Körnigkeitseindruck entsteht. An hellen Negativstellen sind nur wenige Körner und somit wenige Korn-Nicht-Korn-Stellen vorhanden. Bei dunklen Negativstellen sitzen die Körner so dicht, daß Lücken nur winzig oder gar nicht vorhanden sind.
Die Mikroskopaufnahmen in Abbildung 4.3 zeigen ein Schwarzweißnegativ in 40-facher, 100-facher und 400-facher Vergrößerung. Dabei kann man die einzelnen Silberkörner und deren Verteilung gut erkennen. Je kleiner die Silberkörner sind, desto feinkörniger und schärfer ist ein Film.
Die Schwärzungskurve
Bereits im Jahre 1890 wurde die Schwärzungskurve durch den Schweizer FERDINAND HURTER (1844-1898) und den Engländer VERO CHARLES DRIFFIELD (1848-1915) populär. Sie beschreibt die Stärke der Schwärzung auf der Filmschicht, die durch unterschiedliche Lichtmengen während der Belichtung verursacht wird. Die Filmhersteller liefern auf Wunsch zu ihren Filmen Datenblätter mit Schwärzungskurven aus, mit deren Hilfe der Fotograf die Belichtungsmessung gezielt durchführen und gegebenenfalls mit der Entwicklung abstimmen kann.
Aus der Schwärzungskurve läßt sich ablesen, wie Helligkeitsunterschiede im Motiv als Helligkeitsunterschiede auf dem Film wiedergegeben werden. Für eine `naturgetreue' Wiedergabe sollte eine doppelt so helle Motivstelle im späteren Bild auch doppelt so hell erscheinen, eine dreifach hellere dreimal so hell usw.
Abbildung 4.4 auf zeigt die Schwärzungskurve eines Schwarzweißnegativfilms. Waagrecht ist die Lichtmenge, die den Film belichtet, abzulesen. Je weiter man nach rechts geht, desto heller ist das Licht. Senkrecht kann man die Stärke der Schwärzung ablesen, die durch eine bestimmte Lichtmenge verursacht wurde. Je weiter oben abgelesen wird, desto stärker ist die Schwärzung und um so dunkler das Negativ. Zum Ablesen geht man von einer Lichtmengenstelle auf der waagrechten Achse senkrecht nach oben, bis man auf die Kurve trifft. Auf der senkrechten Achse kann man dann für diesen Punkt entnehmen, welche Schwärzung die Lichtmenge verursacht hat.
Als Maßeinheiten für die Lichtmenge können z.B. das Lux oder einfach nur Verhältniswerte angegeben werden, wie das in der Regel der Fall ist. Die Verhältniswerte der waagrechten Achse sind sogenannte Logarithmen mit der Basis 10, also die Hochzahl von 10. Wenn man 10 mit diesen Zahlen potenziert, erhält man die direkten Werte. Die Zahl 1 bedeutet demnach 10, denn 10 hoch 1 ist 10. Die Zahl 2 steht für 100 und die Zahl 3 bezeichnet den Wert usw. Natürlich kann man 10 auch mit nicht ganzzahligen Werten potenzieren, z.B. mit 0,1, 0,3 oder 1,5. Mit Hilfe eines wissenschaftlichen Taschenrechners lassen sich die Ergebnisse leicht ausrechnen.
Von einer Zahl zur nächsten, die um 1 größer ist, verzehnfacht sich die den Film belichtende Lichtmenge. Ein Schritt um 0,3 nach rechts bedeutet eine Verdoppelung der Lichtmenge.
2. Man spricht hier auch von relativer Belichtung, weil man zwar ablesen kann, um welchen Faktor sich eine bestimmte Lichtmenge von einer anderen unterscheidet, die direkte Angabe einer Beleuchtungsgröße, z.B. die Beleuchtungsstärke in Lux, fehlt jedoch.
Die Zahlen auf der senkrechten Achse beschreiben die Stärke der Schwärzung in Dichtewerten. Die Dichte ist ein Maß für die Lichtundurchlässigkeit des Films und ist um so größer, je weniger Licht hindurchgelassen wird. Zu ihrer Bestimmung schickt man Licht durch das Negativ und mißt sowohl die Lichtmenge, bevor das Licht durch das Negativ geht, als auch die Lichtmenge, die das Negativ passiert hat. Das Verhältnis der eingestrahlten Lichtmenge zur durchgelassenen Lichtmenge wird als Opazität bezeichnet. Wenn eine Negativstelle nur 1/100 des Lichts hindurchläßt, ist die eingestrahlte Menge 100 mal so groß wie die durchgelassene Lichtmenge und die Opazität beträgt demnach 100.
Die Dichte ist der Zehner-Logarithmus der Opazität. Der Dichtewert 2 besagt, daß der Film nur 1/100 der Lichtmenge hindurchläßt, denn die Opazität beträgt 100 und der Zehner-Logarithmus von 100 ist 2. Die Zahl 3 beschreibt schon ein kohlrabenschwarzes Negativstück: Vom eingestrahlten Licht wird nur der tausendste Teil hindurchgelassen.
Betrachten wir einmal Abbildung 4.4 auf Seite etwas näher. Die Kurve beginnt links geringfügig oberhalb der Dichte Null. Dieser Bereich ist mit der Ziffer 1 gekennzeichnet und besitzt den Namen (Grund-) Schleier. Er entsteht durch den Entwickler. Selbst wenn Bildstellen nicht belichtet wurden, erzeugt der Entwickler geringe Mengen Silber, so daß der Film dort nicht hundert Prozent Licht, sondern etwas weniger durchläßt. Im Bereich des Schleiers verläuft die Kurve parallel zur Lichtmengenachse.
Erst ab einer bestimmten Lichtmenge wird der Film stärker als durch die schleiernde Wirkung des Entwicklers geschwärzt. Von dort an beginnt die Kurve nach oben zu verlaufen, zu steigen. Der mit Ziffer 2 gekennzeichnete Teil heißt Durchhang.
Die Filmempfindlichkeit wird 0,1 Dichteeinheiten oberhalb des Schleiers gemessen: Man geht von der senkrechten Achse ab dem Schleierwert um 0,1 Einheiten nach oben und dann nach rechts bis zur Kurve. Wo man diese trifft, läßt sich auf der waagrechten Achse die Lichtmenge ablesen, welche den Film für das Auge sichtbar stärker als der Grundschleier schwärzt. Je geringer die dazu notwendige Lichtmenge ist, desto lichtempfindlicher ist der Film.
Übrigens: 1 DIN Empfindlichkeitsunterschied entspricht einem Dichteunterschied von 0,1. Das heißt, wenn ein um 1 DIN lichtempfindlicherer Film von der gleichen Lichtmenge belichtet wird, so ist seine Dichte um 0,1 größer. Das ist das 1,26-fache. Der Meßpunkt der Empfindlichkeit ist in Abbildung 4.4 mit dem Buchstaben `E' gekennzeichnet.
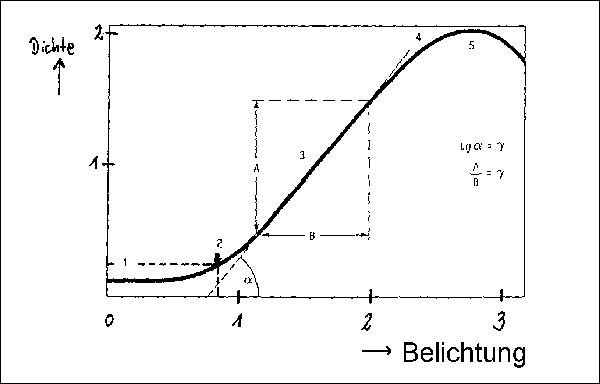
Abbildung: Schwärzungskurve eines
Schwarzweißnegativfilms. Die Zahlen auf der waagrechten Achse
beschreiben die Lichtmenge, auf der senkrechten Achse ist die Negativdichte
(Lichtundurchlässigkeit) aufgetragen. Die Abstufung ist logarithmisch, bei
einer um 1 größeren Zahl hat sich die Intensität um das 10-fache erhöht.
1=Schleier, 2=Durchhang (Schwelle), 3=geradliniger Teil, 4=Schulter,
5=Maximaldichte
Nach Ziffer 2 verläuft die Kurve in etwa geradlinig (Ziffer 3). Dieser Bereich bestimmt die wesentlichen Eigenschaften des Films. Nach ihm richtet sich die Belichtungsmessung. Der geradlinige Kurventeil bestimmt, wie Unterschiede in der Motivhelligkeit später auf dem Foto erscheinen. Diese können ebenso wie in Wirklichkeit wiedergegeben werden, aber auch stärker oder schwächer. Entweder erscheint eine doppelt so helle Motivstelle auch auf dem Foto doppelt so hell oder aber weniger oder mehr.
Ab Ziffer 4 verläuft die Kurve wieder deutlich flacher. Dieser Bereich wird als Schulter bezeichnet. Sowohl in der Schulter als auch im Durchhang werden unterschiedliche Motivhelligkeiten weniger verschieden als in Wirklichkeit wiedergegeben. Doppelt so helle Motivstellen in Schulter und Durchhang erscheinen auf dem entwickelten (Positiv-) Bild weniger als doppelt so hell.
Ziffer 5 in Abbildung 4.4 ist der höchste Punkt der Kurve und heißt Maximaldichte. Dort ist der Film am dunkelsten und läßt am wenigsten Licht hindurch.
Durch eine noch stärkere Belichtung, welche die Maximaldichte verursacht, verliert der Film wieder an Dichte. Die Kurve verläuft dann nach unten; die Aufnahme `kehrt sich um'. Dieser Bereich wird als Solarisationsbereich bezeichnet und für Direktpositivmaterial genutzt. Dazu werden die Filme vor der Belichtung bis zur Maximaldichte geschwärzt. Die
Entwicklung nach erneuter Belichtung ergibt dann Diapositive.
Befassen wir uns einmal näher mit dem geradlinigen Teil der Schwärzungskurve: Dieser kann flach oder steil verlaufen.
Eine geringe Kurvensteigung bedeutet, daß Helligkeitsunterschiede des Motivs weniger unterschiedlich auf dem Film wiedergegeben werden. Ein starke Steigung bewirkt, daß Motivhelligkeitsunterschiede auf dem Film drastischer ausfallen. Nur wenn der geradlinige Kurventeil im 45 Winkel steigt, erscheinen Unterschiede in der Motivhelligkeit gleichermaßen abgestuft auf dem Film.
In Abbildung 4.4 ist der geradlinige Kurventeil durch eine gestrichelte Linie verlängert. Im Schnittpunkt der Verlängerung mit der horizontalen Achse ist der griechische Buchstabe Alpha eingezeichnet, der den Winkel der Kurvensteigung im geradlinigen Mittelteil bezeichnet. In der Abbildung ist er etwas größer als 45. Wenn man also von einer Zahl auf der Lichtmengenachse, zur Kurve hochgeht und dann nach links und dies mit einer anderen Zahl wiederholt, wird man feststellen, daß die Differenz zwischen beiden Zahlen auf der senkrechten Achse größer ist. Das bedeutet, daß dieser Film Motivhelligkeitsunterschiede stärker registriert.
Die Steigung der Kurve wird auch als Gammawert bezeichnet. Er ist nichts anderes als der Tangens, eine Winkelfunktion, des eingezeichneten Winkels Alpha. Je größer der Gammawert ist, desto stärker steigt die Kurve.
Die Filmentwicklung übt einen nicht unwesentlichen Einfluß auf den Gammawert aus. Wenn man den Film länger entwickelt, wächst der Gammawert, kürzere Entwicklungszeiten bewirken einen geringeren Gammawert.
Der Gammawert wird auch als Gradation des Filmes bezeichnet. Wenn die Kurve schwach steigt, der Winkel also weniger als 45 Error! Reference source not found. und der Gammawert kleiner als 1 ist, spricht man von einer flachen Gradation. Man sagt dann auch, der Film arbeitet weich und besitzt viele Graustufen. Steigt die Kurve stärker als 45 Error! Reference source not found. an, so spricht man von einer steilen Gradation. Dabei werden Helligkeitsunterschiede stärker wiedergegeben. Der Film arbeitet hart und besitzt weniger Graustufen als ein weich arbeitender. Negativfilme besitzen üblicherweise auf einen Gammawert von 0,6 bis 0,7, Diafilme einen von 1,5.
Diafilme weisen eine steile Gradation auf, damit sie im Durchlicht der Projektion brillant erscheinen. Negativfilme hingegen haben eine flache Gradation, damit sie nach Umkopieren auf Fotopapier nicht zu hart sind und damit möglichst viele im Film erkennbare Motivdetails auch auf dem Papier erkennbar sind.
Die Schwärzungskurve ist bei der Ermittlung der Belichtung von besonderer Bedeutung. In Abbildung 4.5 ist noch einmal die Schwärzungskurve aus Abbildung 4.4 zu sehen, allerdings mit eingezeichnetem Intervall der richtigen Belichtung.
Jedes Motiv hat von der hellsten bis zu dunkelsten Stelle einen gewissen Helligkeitsumfang, der als Motivkontrast bezeichnet wird. Ist die hellste Motivstelle 30 mal heller als die dunkelste, beträgt der Helligkeitsumfang 1:30. Der geradlinige Kurventeil in der Abbildung erstreckt sich etwa über 1,5 Einheiten, was einem Belichtungsumfang von rund 1:30 entspricht. In diesem Fall kann ein Motiv mit einem Helligkeitsumfang bis 1:30 in seiner gesamten Helligkeitsabstufung wiedergegeben werden.
In der Natur ist der Helligkeitsumfang des Motives oft größer als 1:30. Der Film in Abbildung 4.5 kann aber nur Helligkeitsumfänge bis 1:30 bewältigen. Das bedeutet, daß in diesem Fall nur ein bestimmter Motivbereich wiedergegeben werden kann. Der Rest des Motives erscheint auf dem Film schwarz oder weiß.
Wenn der Helligkeitsumfang des Motives geringer als der Belichtungsumfang des Films ist, besitzt der Film einen Belichtungsspielraum. In der Abbildung 4.5 ist das Belichtungsintervall, also der Helligkeitsunterschied im Motiv, geringer als das Intervall der richtigen Belichtung, d.h. Belichtungsumfang des Films. Somit besitzt der Film einen Belichtungsspielraum. Das Belichtungsintervall läßt sich innerhalb des Intervalls der richtigen Belichtung hin- und herschieben. Der Fotograf kann kürzer oder länger belichten. Dabei wird er normalerweise eine kürzere Belichtungszeit wählen, um das Bild weniger zu verwackeln.
Der Belichtungsumfang eines Films hängt von der Filmart, seiner Lichtempfindlichkeit und der Entwicklung ab. Diafilme können einen Motivkontrast bis etwa 1:64 bewältigen, Negativfilme bis 1:32 und mehr. Hochempfindliche Schwarzweißfilme verkraften sogar Helligkeitsunterschiede bis 1:2000. Problematisch ist jedoch die Vergrößerung auf Fotopapier, das normalerweise nur Negativkontraste bis 1:16 wiedergeben kann. Größere Helligkeitsunterschiede lassen
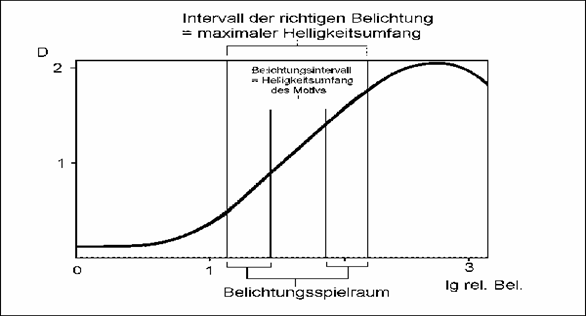 sich während der Belichtung
auf Papier bewältigen, indem man zu dunkle Negativstellen länger belichtet und
zu helle kürzer.
sich während der Belichtung
auf Papier bewältigen, indem man zu dunkle Negativstellen länger belichtet und
zu helle kürzer.
Abbildung: Belichtungsspielraum eines
Schwarzweißnegativfilms. Wenn der Helligkeitsumfang des Motives geringer
ist als der maximale Helligkeitsumfang, den ein Film wiederzugeben vermag, so
besitzt der Film einen Belichtungsspielraum. Der Fotograf kann dann kürzer oder
länger belichten, als der Belichtungsmesser anzeigt.
Der Belichtungsspielraum eines Diafilms ist nur gering, trotz seiner Fähigkeit, einen großen Motivkontrast wiederzugeben. Denn die Belichtungsintensität beeinflußt wesentlich die Farbwiedergabe. Hierzu sehe man sich einmal die Farbdichtekurven in Abbildung 4.12 auf Seite an. Geringe Belichtungsunterschiede bewirken eine relativ große Farbdichteänderung. Angenommen ein `mittelhelles' Grün soll auf dem Dia auch mittelhell erscheinen. Dann muß es so belichtet werden, daß es sich in der Abbildung 4.12 auf der Farbdichtekurve etwa bei der Belichtungsintensität von -1,25 befindet.
Bereits eine Abweichung auf eine Intensität von -1,5 bewirkt eine deutlich größere Farbdichte. Das Grün erscheint dadurch dunkler als `in Wirklichkeit'. Besonders kritisch wirkt sich das bei der Wiedergabe menschlicher Haut aus, die dann unnatürlich wirkt.
Während man Dias direkt betrachtet, schaut man Negative nicht direkt an, sondern vielmehr die aus den Negativen gewonnenen Papierbilder. Unzulänglichkeiten in der Negativbelichtung kann man während des Vergrößerns auf Fotopapier ausgleichen. Um beim Beispiel des mittelhellen Grüns zu bleiben: Man belichtet das Fotopapier einfach länger oder kürzer, so daß auf dem Papier das Grün mittelhell erscheint.
Der Unterschied des Belichtungsspielraums zwischen Negativ- und Diafilm soll anhand eines weiteren Beispiels betrachtet werden: Man fotografiert ein Menschenporträt. Das Gesicht hat eine mittelhelle (`europäische') Hautfarbe und füllt beinahe das ganze Bild aus. Der Hintergrund ist weiß und ohne Struktur. Er spielt keine Rolle bei der Belichtung, weil auf ihm nichts zu erkennen sein muß. Wenn der Hintergrund eine Struktur hätte und erkennbar sein sollte, so müßte er bei der Belichtung berücksichtigt werden. Beim Negativfilm müßte er dann noch irgendwo innerhalb der Schwärzungskurve abgebildet werden, beim Diafilm hat das Porträt Vorrang. Man müßte in diesem Falle entweder die Helligkeit des Hintergrunds an das Porträt anpassen oder umgekehrt. Näheres dazu steht im Kapitel `Belichtungsmessung'.
Wird beim Diafilm das Gesicht am `hellen' oder `dunklen' Ende des Intervalls der richtigen Belichtung abgebildet, so ist es viel zu hell oder viel zu dunkel und hat eine unnatürliche Farbe. Obwohl noch alle Gesichtsdetails erkennbar sind, empfindet der Betrachter die Gesichtswiedergabe als unnatürlich, weil die Hautfarbe ein wichtiges Merkmal des Menschen ist.
Der Diafilm muß deshalb so belichtet werden, daß das mittelhelle Gesicht auch einen `mittleren' Belichtungseindruck hinterläßt. Entsprechend muß ein dunkles Gesicht einen geringeren Belichtungseindruck hinterlassen und ein helleres Gesicht einen stärkeren Belichtungseindruck.
Beim Negativfilm kann ein Gesicht beliebiger Farbe innerhalb des Intervalls der richtigen Belichtung praktisch auf jeden Punkt der Schwärzungskurve liegen. Man muß lediglich beim Vergrößern darauf achten, daß auf dem Papierbild die Hautfarbe in der richtigen Helligkeit wiedergegeben wird.
Nicht nur der Fotograf, auch Kamerahersteller und Labors profitieren vom Belichtungsspielraum, der bei modernen Negativfilmen recht groß ist. Dank des Spielraums kann man preiswerte Kompaktkameras herstellen, die keinen oder nur einen ungenauen Belichtungsmesser besitzen.
Die Vergrößerungsgeräte der Labors stellen sich automatisch auf eine vom Durchschnitt abweichende Belichtung ein. Weil auch fehlbelichtete Negative meist noch akzeptable Resultate bringen, erspart sich das Labor möglichen Arger mit den Kunden.
Dieser Umstand sollte aber nicht dazu führen, daß der Leser zu sich sagt: `Belichtung ist nicht so wichtig. Der Film fängt Fehler doch sowieso ab'. Erstens liefern richtig belichtete Filme immer noch bessere Ergebnisse als fehlbelichtete, besonders was die Farbwiedergabe anbelangt. Zweitens ist der Belichtungsspielraum der Filme auch nicht so groß. Wenn das Motiv einen großen Kontrastumfang hat, ist unter Umständen überhaupt kein Belichtungsspielraum mehr vorhanden. Und drittens gilt ein großzügiger Belichtungsspielraum nur für Negativfilme. Diafilme, die direkt betrachtet werden, haben praktisch keinen Belichtungsspielraum.
Ausführlicher wird die Belichtung im Kapitel `Belichtungsmessung' behandelt.
Am besten ermittelt der Fotograf den Belichtungsumfang seiner Filme durch einen Test . Dazu fotografiert er eine gleichmäßig schattenfrei beleuchtete markante Oberflächenstruktur, z.B. ein rauhes Handtuch. Die Farbe des Objekts sollte ein mittelhelles Grau sein. Zuerst belichtet er genau nach Belichtungsmesseranzeige. Dann wird bei gleichbleibender Blende mit den nächsten 6 kürzeren, anschließend mit den 6 folgenden längeren Belichtungszeiten fotografiert. Ermittelt man z.B. 1/30 Sekunde bei Blende 16, fotografiert man außer mit dieser Einstellung bei Blende 16 noch mit 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 und 1/2000 Sekunde und anschließend mit 1/15, 1/8 1/4, 1/2 Sekunde. Dann beläßt man 1/2 Sekunde und verstellt die Blende einmal auf 11, dann auf 8, denn bei manchen Filmen ändert sich die Empfindlichkeit bei Belichtungszeiten von 1 Sekunde und länger.
Der Film wird wie üblich entwickelt. Das hellste und dunkelste Negativ oder Dia, auf dem man die Oberflächenstruktur gerade noch erkennen kann, markieren die Grenzen des Belichtungsumfangs. Er beträgt 1 zu 2 hoch Anzahl der Bilder mit erkennbarer Objektstruktur. Wenn auf 10 Bildern noch eine Struktur zu sehen ist, beläuft sich der Belichtungsumfang auf 1:210, das ist etwa 1:1000. Man wird feststellen, daß sich an den Grenzen die hellsten und dunkelsten Bilder kaum unterscheiden. Das vorletzte Bild ist fast genauso dunkel wie das letzte, bzw. genauso hell. Außerdem sind die zu reichlich belichteten Fotos unschärfer. Der für die bildmäßige Fotografie nutzbare Bereich zeichnet sich durch gute Erkennbarkeit der Struktur sowie Unterscheidbarkeit der verschieden belichteten Bilder aus. Man sollte lediglich diesen Bereich für die Belichtungsmessung heranziehen.
Zum Abschluß noch zwei Bemerkungen: Moderne Schwarzweißfilme besitzen nicht unbedingt einen geradlinigen Mittelteil in der Schwärzungskurve, haben also auch keinen Gammawert, sondern einen Betawert, auf dessen Errechnung hier nicht näher eingegangen werden soll. Nur soviel: Bei gleicher Gradation sind Betawerte etwas niedriger als Gammawerte. Während Gammawerte normaler Filme um 0,6 bis 0,7 liegen, belaufen sich deren Betawerte auf 0,55 bis 0,6.
Die Gradation eines Schwarzweißfilms kann innerhalb gewisser Grenzen durch die Entwicklung verändert werden. Eine verlängerte Entwicklung erhöht die Gradation und verringert den Belichtungsumfang, eine Verkürzung der Entwicklungsdauer führt zu einer flacheren Gradation und erhöhtem Belichtungsumfang. Die Belichtung muß bei längerer Entwicklung verringert werden, bei kürzerer Entwicklung vergrößert. Auskunft über die genauen Belichtungs- und Entwicklungsveränderungen geben Datenblätter von Firmen, die Entwicklungschemikalien herstellen. Der Fotograf ist so in der Lage, durch gezielte Belichtung und Entwicklung Motive mit einem größeren oder geringeren Helligkeitsumfang als derjenige, für den der Film normalerweise ausgelegt ist, trotzdem gut abgestuft wiederzugeben.
4.1.6 Farbempfindlichkeit (spektrale Empfindlichkeit)
Schwarzweißfilme bilden das Motiv nicht nur in Schwarz und Weiß ab, wie es der Name vermuten läßt; in der Regel besteht das Foto aus Schwarz, Weiß und verschiedenen Grautönen.
Damit man Objekte von unterschiedlicher Farbe aber gleicher Helligkeit auf dem Schwarzweißfoto auseinanderhalten kann, wenn sie sich überdecken, muß jede Farbe als anderes Grau wiedergegeben werden. Es ist also sinnvoll, die Farbempfindlichkeit eines Schwarzweißfilms zu kennen.
Die lichtempfindlichen Stoffe des Films, die Silberhalogenide, sind normalerweise nur für blaues bis blaugrünes Licht empfindlich. Gelbes, grünes und rotes Licht würde unsensibilisierte Filme nicht belichten. Die Bildstellen würden schwarz sein, wo das Motiv gelb, grün oder rot ist. Wenn der Fotograf mit einen solchen Film einen roten Apfel vor grünem Hintergrund fotografiert, erhält er lediglich ein schwarzes Bild, abgesehen von weißen Lichtreflexen auf Apfel und Hintergrund.
Abbildung 4.6: Spektrale Empfindlichkeit eines
SW-Films. Der Schwarzweißfilm (hier Agfapan APX 25 Professional) ist für
die meisten Farben nicht gleichermaßen empfindlich. So wird Blau deutlich
heller als Rot wiedergegeben. Dennoch erscheinen einige Farben in der gleichen
Helligkeit (z.B. 490nm und 650nm).
Deshalb werden die Filme auch für andere Farben empfindlich gemacht, d.h. sensibilisiert. Dazu verwendet man Sensibilatoren . Das sind Farbstoffe, die der Emulsion beigemischt werden.
Es gibt drei unterschiedlich sensibilisierte Filme: Am häufigsten werden wohl panchromatische Filme verwendet, die für alle Farben empfindlich sind. Sie sind die Standardfilme der Schwarzweißfotografen.
Orthochromatische Filme sind für die Farben Blau, Grün und Orange empfindlich. Rot wird als Schwarz wiedergegeben. Das hat den Vorteil, daß sie in der Dunkelkammer bei Rotlicht entwickelt werden können.
Panchromatische Filme müssen in völliger Dunkelheit entwickelt werden. Dabei ist eine Kontrolle des Ergebnisses während der Entwicklung nicht möglich. Aufgrund ihrer steilen Gradation und hohen Maximaldichte werden orthochromatische Filme gerne zur Reproduktion von Strichvorlagen, z.B. eines Textes, verwendet.
Infrarotfilme zeichnen auch das für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotlicht jenseits von 700 nm auf, nämlich zwischen 700 nm und 900 nm (1 nm = 1 Nanometer = 1 Millionstel Millimeter). Eine umfassendere Beschreibung des Lichts befindet sich im Kapitel Objektive.
Infrarotfilme werden von Amateuren gerne für kreative Zwecke verwendet, weil sie alles auf ungewohnte Weise wiedergeben. Bei Landschaftsaufnahmen erscheinen grünbelaubte Bäume weiß wie mit Eiskristallen überzogen und der Himmel schwarz. Außerdem kann man damit Fernsichtaufnahmen machen, die wesentlich klarer sind als mit herkömmlichen Filmen. Es ist sogar möglich, leichten Nebel zu durchdringen.
Man sollte zur Schwarzweiß-Infrarotfotografie ein starkes Rotfilter bzw. spezielles Infrarotfilter verwenden. Die Belichtungszeiten werden dabei sehr lang, so daß man ein Stativ benötigt.
Belichtungszeiten für Infrarotfilme kann man nur anhaltsweise ermitteln. Die Belichtungszeiten hängen davon ab, wieviel infrarotes Licht vom Motiv reflektiert wird. Ein Belichtungsmesser kann hier keinen genauen Wert ermitteln, sondern gibt lediglich Anhaltswerte, denn er ist unempfindlich für infrarotes Licht. Bei der Infrarotfotografie stützt man sich deshalb bezüglich der Belichtung auf Erfahrungswerte. Am besten, man macht vom gleichen Motiv mehrere Aufnahmen mit vom Schätzwert abweichenden Belichtungszeiten, um möglichst sicher zu sein, daß eine Aufnahme richtig belichtet ist. Hilfreich dürften hierbei Informationen vom Hersteller des Films sein.
Die Entfernungseinstellung am Objektiv muß auf eine spezielle Markierung, den Infrarotindex, vorgenommen werden. Das ist ein zusätzlicher Strich, der meist rote Farbe hat und mit einem großen R gekennzeichnet ist. Stellt man die Schärfe so ein, daß man an der normalen Entfernungseinstellungsmarkierung `Unendlich' ablesen kann, muß der Objektivring so verstellt werden, daß das Unendlichzeichen, die gekippte Acht, dem Infrarotindex gegenübersteht.
Aufgrund der komplizierten Ermittlung der richtigen Belichtungszeit, den schlecht kalkulierbaren Ergebnissen und den starken Einfluß von Farbfiltern gilt: Bevor man mit Infrarotfilmen fotografiert, sollte man auf jeden Fall das Datenblatt zum Film vom Filmhersteller anfordern und gut durchlesen. Dort sollten einige wichtige Hinweise zu finden sein.
Abbildung 4.6 zeigt die Farbempfindlichkeit eines panchromatischen Schwarzweißfilmes. Wie man sieht, ist dieser für verschiedene Farben auch unterschiedlich empfindlich. Die Kurve hat einen deutlichen Tiefpunkt nahe der Wellenlänge 500 Nanometer bei Blaugrün und fällt ab 650 Nanometer nach Rot (um 700 nm) hin stark ab. Wenn im Motiv beispielsweise ein Blaugrün genauso hell wie Grün ist, wird es auf dem Foto nicht genauso hell, sondern dunkler wiedergegeben.
Die Kurve zeigt aber auch, daß verschiedene Farben leider nicht immer als unterschiedliche Grautöne wiedergegeben werden, weil mehrere Wellenlängen die gleiche Empfindlichkeit aufweisen. In der Praxis wirkt sich das dann so aus: Eine rote Rose vor grünen Hintergrund erscheint als Grau-in-Grau-Motiv.
Um das zu vermeiden, verwendet der Schwarzweißfotograf Farbfilter, beispielsweise ein Rotfilter. Damit ist er in der Lage, Motivfarben heller oder dunkler wiederzugeben. Näheres dazu steht im Kapitel `Filter'. Aber Sie sollten schon jetzt einmal die Bilder auf Seite betrachten. Dort ist ein Baum vor Himmel mit Wolken zu sehen. Wenn der Baum ohne Filter fotografiert wird, steht er vor hellem, blassen, Hintergrund mit schlecht erkennbaren Wolken. Durch ein Gelbfilter fotografiert, zeichnen sich die Wolken deutlicher vor etwas dunklerem Himmel ab.
Ein Rotfilter ändert das Bild dramatischer: Der Himmel ist noch dunkler und die Wolken erstrahlen im hellen Weiß.
4.1.7 Lichtempfindlichkeit
Die Lichtempfindlichkeit, auch Filmempfindlichkeit, eines Filmes ist als ISO-Zahl auf jede Filmverpackung gedruckt. ISO steht für `International Organization for Standardization' und setzt sich aus den bis Mitte der 80er Jahre üblichen DIN (Deutsche Industrienorm)- und ASA (American Standards Association)-Werten zusammen.
Zur Ermittlung der Filmempfindlichkeit wird mit einer genau dosierten Lichtmenge auf den Film ein Durchsichtsgraukeil aufbelichtet. Das ist eine transparente Folie, deren Lichtdurchlässigkeit stufenförmig in 0,1 Dichtewerten zu- oder abnimmt. An seiner hellsten Stelle läßt der Graukeil praktisch das gesamte Licht hindurch, im darauffolgenden Streifen 1/1,26, danach 1/1,6 usw. Der letzte Streifen läßt schließlich überhaupt kein Licht mehr hindurch. Die Keilstufe, welche die Schwärzung 0,1 über dem Grundschleier erzielt, bestimmt die Filmempfindlichkeit. Multipliziert man deren Wert mit 10, erhält man die DIN-Zahl
Eine Verdoppelung der Lichtempfindlichkeit drückt sich entweder in einer Verdoppelung des ASA-Wertes oder Erhöhung des DIN-Wertes um drei aus. So ist beispielsweise ein 200 ASA-Film doppelt so lichtempfindlich wie ein 100 ASA-Film; gleichbedeutend ist ein 24 DIN-Film doppelt so lichtempfindlich wie ein 21 DIN-Film. Entsprechendes gilt natürlich für die aus ASA und DIN zusammengesetzte ISO-Zahl: ISO 200/24 ist doppelt so lichtempfindlich wie ISO 100/21 DIN-Zahl-Differenzen bedeuten das 10-fache der Dichtedifferenzen, ASA-Zahlen drücken den Faktor des Empfindlichkeitsunterschieds direkt aus, wobei allerdings nach Gutdünken gerundet wird.
Um die Lichtmengenunterschiede zu ermitteln, die bei unterschiedlichen Filmempfindlichkeiten die gleiche Belichtung erzielen, muß der Fotograf bei den DIN-Zahlen 10 mit dem Zehntel der DIN-Differenz potenzieren. Das ist ohne Taschenrechner äußerst unpraktisch.
Eine Differenz von 1 DIN bedeutet in bezug auf eine höhere DIN-Zahl die 1,26-fache, 2 DIN Unterschied die 1,6-fache und 3 DIN Unterschied die 2-fache Lichtempfindlichkeit. Bei einer niedrigeren Filmempfindlichkeit muß man durch diese Faktoren teilen. Das Ausrechnen ist dann einfach, wenn die Differenz zwischen neuer und alter DIN-Zahl sich ganzzahlig ohne Rest durch 3 teilen läßt. Weil eine Veränderung um drei DIN einer Verdoppelung oder Halbierung entspricht, muß man so oft verdoppeln bzw. halbieren, wie die Empfindlichkeit um drei DIN geändert wurde. Wenn ein Film eine um 6 DIN höhere Empfindlichkeit besitzt, wurde die Empfindlichkeit um zwei mal drei DIN verändert. Folglich hat sich die Empfindlichkeit zwei mal verdoppelt, also vervierfacht.
Einfacher kann der Fotograf mit den ASA-Zahlen rechnen. Dabei ermittelt man den Faktor der Lichtempfindlichkeitsänderung, indem man den alten ASA-Wert durch den neuen teilt: Ein 800-ASA-Film ist 8mal so lichtempfindlich wie ein 100-ASA-Film, ein 1000-ASA-Film ist 10 mal lichtempfindlicher. Tabelle 1 zeigt eine Gegenüberstellung gleichwertiger ASA und DIN-Zahlen, die zusammengesetzt den ISO-Wert ergeben.
Wenn im folgenden die Filmempfindlichkeit angesprochen wird, so verwende ich die gebräuchlicheren ASA-Werte. Selbst wenn auf modernen LC-Displays der Kameragehäuse häufig ISO steht, so findet sich normalerweise nicht der ISO-Wert daneben, sondern lediglich der ASA-Wert.
Je weniger Licht zur gleichen Schwärzung des Films erforderlich ist, desto lichtempfindlicher ist er. Man kann dann auch noch bei schwachem Licht ohne Stativ frei aus der Hand fotografieren. Um die Filme nach ihrer Lichtempfindlichkeit zu charakterisieren, verwendet man die Begriffe niedrig-, mittel- und hochempfindlich. Welche ASA-Zahlen einen niedrig-, mittel- oder hochempfindlichen Film kennzeichnen, hängt einerseits vom Filmmaterial, Schwarzweiß, Farbe, Dia oder Negativ, ab und andererseits vom Entwicklungsstand der Filmtechnik.
Schwarzweißfilme und Filme mit fortgeschrittener Emulsionstechnik haben in der gleichen Empfindlichkeitsklasse, z.B. mittelempfindlich, eine höhere ASA-Zahl. So ist ein Farbdiafilm mit 200 ASA zur Zeit schon hochempfindlich, während ein Farbnegativfilm dieser ASA-Zahl mittelempfindlich ist. Natürlich sind die Übergänge zwischen den einzelnen Kategorien nicht scharf, sondern fließend. Ein Film mit 64 ASA ist nicht zwangsweise niedrigempfindlich, wenn ein Film mit 100 ASA mittelempfindlich ist. Er kann beiden Klassen zugeordnet werden.
An dieser Stelle muß noch erwähnt werden, daß hochempfindliche Filme gelegentlich noch in höchstempfindliche und niedrigempfindliche in niedrigstempfindliche Filme eingeteilt werden. Weil es aber bereits für die übliche Einstufung niedrig, mittel, hoch, keine verbindliche Norm gibt und diese häufig unterschiedlich vorgenommen wird, soll hier darauf verzichtet werden.
Niedrigempfindliche Filme zeichnen sich durch hohe Schärfe aus. Wenn das Bild stark vergrößert wird, z.B. auf 30x40 cm oder größer, eignen sich diese Filme wegen ihrer Feinkörnigkeit am besten. Aufgrund des kleinen Korndurchmessers sind sie jedoch nur gering lichtempfindlich, da die kleinere Kornoberfläche weniger Licht auffangen kann als eine große. Die Gradation ist im allgemeinen steiler als bei höherempfindlichen Filmen, was zur Folge hat, daß diese Filme weniger Grauabstufungen und einen geringeren Belichtungsumfang besitzen.
Farbdiafilme bis zu einer Empfindlichkeit von ca. 50 ASA und Farbnegativfilme bis zu etwa 100 ASA können als niedrigempfindlich eingestuft werden. Wenn man nicht so streng ist, kann man sogar noch Schwarzweißfilme bis zu 400 ASA dazurechnen.
Aufgrund der geringen Empfindlichkeit muß man die Kamera häufig auf ein Stativ schrauben, um verwacklungsfrei fotografieren zu können. Das gilt besonders dann, wenn lichtschluckende Filter, wie beispielsweise Rotfilter, eingesetzt werden. Deshalb verwendet man niedrigempfindliche Filme vorwiegend für statische Motive, z.B. bei Landschafts- oder Architekturaufnahmen. Diese Motive erfordern meist eine gute Schärfe und bewegen sich nicht, so daß sie mit langen Verschlußzeiten fotografiert werden können.
Mittelempfindliche Filme sind ein guter Kompromiß zwischen niedrig- und hochempfindlichen. Sie werden auch als Standard- oder Allroundfilme bezeichnet. Mittelempfindliche Filme haben einerseits noch feines Korn und sind andererseits empfindlich genug, um damit meistens frei aus der Hand fotografieren zu können.
Mittelempfindlich sind Farbdiafilme um 100 ASA sowie Farbnegativfilme um 200 ASA. Unter nicht allzu strengen Maßstäben zählen auch noch Schwarzweißfilme um 400 ASA dazu.
Diese Filme eignen sich besonders dann, wenn man nicht schon im voraus weiß, was man fotografieren möchte oder vermutlich auf die unterschiedlichsten Motive treffen wird und dafür denselben Film verwenden will. Ist von vornherein klar, daß man nur Häuser oder Landschaften fotografiert, so verwendet man einen niedrigempfindlichen Film und nimmt ein Stativ mit. Will man hingegen aber Schnappschüsse, Architektur und eventuell sogar noch Sportaufnahmen mit dem gleichen Film fotografieren, so ist der Standardfilm die vernünftigste Wahl. Auf die unterschiedlichsten Motive trifft man beispielsweise im Urlaub oder allgemein auf `Fototouren' ohne feste Motivwahl.
Hochempfindliche Filme besitzen gröberes Korn und sind deshalb nicht so gut vergrößerungsfähig. Dafür weisen sie aufgrund der üblicherweise flacheren Gradation einen größeren Belichtungsspielraum auf. Das macht sie insbesondere auch für Motive mit starken Helligkeitsunterschieden interessant, die niedrigerempfindliche Filme aufgrund ihres geringeren Belichtungsumfangs nicht mehr befriedigend wiedergeben können.
Sie werden hauptsächlich für schnell bewegte Motive und für Fotos bei schwachem Licht aus freier Hand eingesetzt. Das sind beispielsweise Sport- oder Tieraufnahmen oder Fotos in Innenräumen ohne Stativ. Hochempfindliche Filme eigenen sich auch hervorragend für Schnappschüsse. Hierbei kann man die Entfernung am Objektiv voreinstellen und eine kleine Blende wählen, so daß es möglich ist, ohne weitere Entfernungseinstellung blitzschnell auszulösen. Dabei werden innerhalb eines großen Bereiches, z.B. von einen bis fünf Metern, alle Aufnahmen scharf. Dieses sogenannte Schnappschußverfahren wird später erklärt.
Farbdiafilme ab 200 ASA können bereits als hochempfindlich bezeichnet werden, bei Farbnegativfilmen gilt dies ab etwa 400 ASA, bei Schwarzweißfilmen ab 800 ASA.
Auf dem Markt sind gegenwärtig Farbdia- sowie Farbnegativ- und Schwarzweißnegativfilme bis zu 3200 ASA erhältlich. Durch eine Spezialentwicklung, wobei die Entwicklungszeit verlängert wird, können die Filme noch etwa bis um das Vierfache in der Empfindlichkeit gesteigert werden, Schwarzweißfilme noch stärker. Dadurch ist es möglich, bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn man z.B. nur einen 400 ASA-Film zur Hand hat, an der Kamera 800 ASA oder auch 1600 ASA einzustellen. Voraussetzung ist, daß der ganze Film mit dieser Einstellung belichtet wird. Außerdem muß man das Fotolabor extra darauf hinweisen, damit es eine Spezialentwicklung vornimmt. Der eben beschriebene Vorgang wird auch Pushen genannt. Je weniger dabei die Filmempfindlichkeit gesteigert wird, desto besser fallen die Ergebnisse aus.
4.2 Farbfilme
Die wichtigsten Unterschiede zwischen Schwarzweiß- und Farbfilmen bestehen darin, daß beim Farbfilm unterschiedliche Farben nicht als verschiedene Grautöne, sondern farbig wiedergegeben werden, und das Bild des Farbfilms letztlich nicht aus Silber, sondern aus Farbstoffen aufgebaut ist.
Ob der Fotograf schwarzweiß oder farbig fotografieren soll, hängt zum einen von technischen Erwägungen ab, z.B. ob das Bild in einem Buch gedruckt werden soll, so daß der Preis eine wichtige Rolle spielt, zum anderen auch hauptsächlich von der Bildgestaltung. Im Gegensatz zu Schwarzweißfilmen wird sie dadurch erschwert, daß neben Linie und Form noch der Aspekt Farbe hinzukommt. In ungünstigen Fällen kann Farbe vom eigentlichen Motiv ablenken und dadurch die Komposition negativ beeinträchtigen. Sie kann aber auch den eigentlichen Reiz des Bildes ausmachen. Damit befaßt sich der zweite Teil des Buches.
Es ist möglich, mit nur drei Farbstoffen alle sichtbaren Farben zu erzeugen. Manchmal weist ein Foto aber auch unnatürliche Farben auf; es ist farbstichig. Warum das so ist, erklärt sich aus der Farbwahrnehmung des Menschen und der Farberzeugung des Films durch Farbmischung, die im folgenden erörtert werden.
4.2.1 Farbwahrnehmung des Menschen
4.2.2 Die Farbmischung
4.2.3 Merkmale der Farbe
4.2.4 Aufbau des Farbfilms
4.2.1 Farbwahrnehmung des Menschen
Physikalisch gesehen ist Farbe nichts anderes als Licht. Unterschiedlichen Wellenlängen werden verschiedene Farben zugeordnet. Das sichtbare Licht beginnt bei Blauviolett (um 410 Nanometer), setzt sich fort über Blau (470 nm), Grün (520 nm), Gelb (590 nm), Orange (620 nm) bis zu Rot (700 nm).
Die Farbe eines Gegenstandes wird durch die spektrale Zusammensetzung des Lichts das dieser reflektiert bzw. hindurchläßt, bestimmt. Farben, die nicht reflektiert oder durchgelassen werden, werden von den Gegenständen `geschluckt' (absorbiert). Der Mensch ordnet auch bei Licht von unterschiedlicher spektraler Zusammensetzung Gegenständen die gleiche Farbe zu. Diese Eigenschaft wird als Farbenkonstanz bezeichnet.
Ein weißes Papierblatt erscheint sowohl unter Sonnenbeleuchtung als auch bei Glühlampenlicht weiß. Allerdings muß die Beleuchtung einen größeren Bereich des sichtbaren Spektrums enthalten. Das weiße Blatt Papier würde unter einer rotfarbigen Glühbirne nicht mehr weiß, sondern rot aussehen, weil die eingefärbte Lampe nur Licht im Wellenlängenbereich um 700 nm enthält.
Der Farbfilm ist weniger anpassungsfähig als das menschliche Auge und Gehirn. Schon mancher unerfahrene Fotograf hat zu seiner Überraschung feststellen müssen, daß Dias bei Glühlampenlicht einen Gelbrotstich bekommen und dann so aussehen, wie durch ein gelbrotes Glas betrachtet.
Licht setzt sich normalerweise aus verschiedenen Wellenlängen zusammen. Das Spektrum von Temperaturstrahlern wie der Sonne oder von Glühlampen besitzt beinahe alle sichtbaren Farben, und erscheint in deren Mischung Weiß. Im Gegensatz dazu besitzen einfarbige Lichtquellen, wie beispielsweise eine rot angefärbte Glühbirne, nur einen bestimmten Spektralbereich, z.B. bei Rot um 700 nm.
Aus biologischer Sicht sind Auge und Gehirn für die Farbwahrnehmung verantwortlich. Wir lassen die etwas kompliziertere Farbverarbeitung des Gehirns außer acht und beschränken uns auf das Auge. In dessen Netzhaut sind etwa 6 Millionen Sinneszellen, die Zapfen, für das Farbsehen zuständig.
Es gibt drei verschiedene Zapfensorten. Jede ist für bestimmte Wellenlängen des Lichts unterschiedlich empfindlich. So hat die erste Sorte eine maximale Empfindlichkeit für Licht der Wellenlänge von ungefähr 430 Nanometer. Die zweite und dritte Sorte haben die höchste Empfindlichkeit bei 530 bzw. 560 Nanometer. Nach ihrer maximalen Farbenempfindlichkeit werden die Zapfen auch Blau, Grün und Rot genannt. Das heißt nicht, daß diese Zapfen keine andere Wellenlänge, d.h. Farbe, wahrnehmen. Sie sind nur weniger empfindlich für andere Farben. Das Gehirn erzeugt aus den drei unterschiedlichen Farbreizen alle anderen Farben.
Die Farben Blau, Grün und Rot werden auch als Grundfarben bezeichnet. Mit nur drei Grundfarben lassen sich durch Mischung alle anderen Farben herstellen, die wir sehen können, und das sind etwa 7 Millionen.
4.2.2 Die Farbmischung
Es gibt zwei Arten der Farbmischung: Die additive und die subtraktive. Zur Herstellung von Farbfotos wird vorwiegend das Verfahren der subtraktiven Farbmischung angewandt. Das besondere bei der Farbmischung ist, daß man mit nur drei Farben, den Grundfarben, alle anderen bekannten Farben zusammenmischen kann.
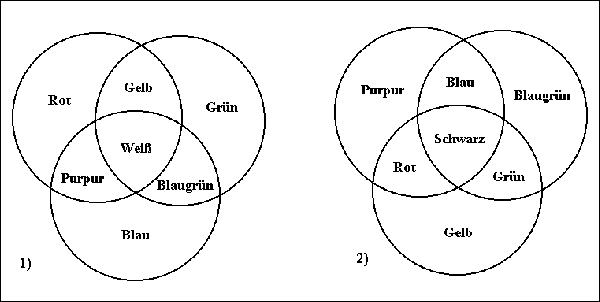
Abbildung 4.7: Farbmischung. 1) additive Farbmischung 2) subtraktive Farbmischung
Eine Komplementärfarbe ergänzt eine Farbe bei der additiven Farbmischung zu Weiß. Bei der subtraktiven Farbmischung entsteht Schwarz. Typische Komplementärfarben sind beispielsweise Blau und Gelb (= additiv Grün-Rot), Grün und Purpur (Blau-Rot) sowie Rot und Blaugrün (Blau-Grün).
Die additive Farbmischung entsteht, wenn auf die gleiche Netzhautstelle des Auges Licht verschiedener Wellenlänge fällt. Um das zu erreichen, werden bei Farbdrucken, beispielsweise in Zeitschriften, winzige, verschiedenfarbige Punkte ganz dicht nebeneinander gedruckt. Das Auge kann die einzelnen Punkte nicht mehr auflösen und nimmt statt dessen eine einheitliche Fläche in der Mischfarbe wahr. Mit einer ab ca. 8-fach vergrößernden Lupe können Sie die räumliche Trennung der Bildpunkte bei Farbdrucken gut erkennen. Auch das Farbfernsehbild entsteht durch additive Farbmischung. Wenn Sie einmal ganz nahe an die Bildröhre Ihres eingeschalteten Fernsehapparates herangehen, können Sie erkennen, daß die einzelnen Bildpunkte aus den Farben Rot, Grün und Blau bestehen.
Eine andere Möglichkeit der additiven Farbmischung besteht in der Übereinanderprojektion farbigen Lichts auf eine weiße Fläche. Besitzen die Grundfarben Blau, Grün und Rot die gleiche Intensität, ergibt deren Mischung Weiß. Blau und Grün ergeben übereinander projiziert Blaugrün, Blau und Rot werden zur additiven Mischfarbe Purpur. Blaugrün wird auch als Cyan und Purpur als Magenta bezeichnet. Mischt man Rot mit Grün, erweckt das den Farbeindruck Gelb (Abbildung4.7).
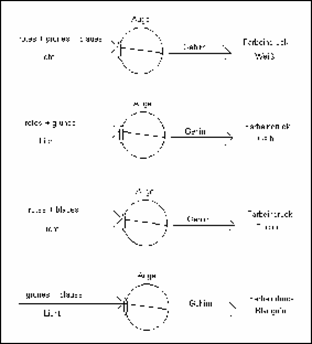
Abbildung
4.8: Entstehung der additiven Farbmischung. Auf die gleiche
Netzhautstelle des Auges gelangt Licht unterschiedlicher Farbe, das in der
Mischung den Farbeindruck ergibt.
Bei der subtraktiven Farbmischung entsteht die Farbe, indem man Farbstofflösungen (Pigmente) miteinander vermischt oder farbige Filter hintereinander schaltet. Die Mischfarben der additiven Grundfarben ergeben die subtraktiven Grundfarben Blaugrün, Purpur und Gelb. Aus diesen kann man wieder die additiven Grundfarben zurückgewinnen (Abbildung 4.7).
Die Wirkungsweise der subtraktiven Farbmischung läßt sich folgendermaßen erklären: Die Farbstoffe der Mischfarbe entziehen (subtrahieren aus) der Lichtquelle, welche die Farbe beleuchtet, bestimmte Farbanteile. In der Natur ist Licht immer eine Mischung aus vielen Farben. Die Pigmente der Mischfarbe schlucken nun einzelne Farben des Lichts weg. Die Farbanteile des Lichts, die nicht absorbiert -- also reflektiert -- werden, ergeben in der (additiven) Mischung die Farbe, die man sieht.
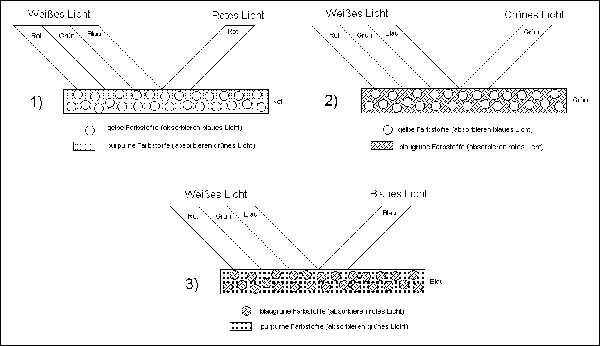
Abbildung
4.9: Entstehung der subtraktiven Farbmischung. Die subtraktive
Farbmischung entsteht, indem der Farbstoff dem Licht gewisse Farbanteile
entzieht (subtrahiert) und die restlichen Farbanteile reflektiert. Die Farbe
ist die additive Mischung der reflektierten Farben.
Jeder Gegenstand absorbiert die zu seiner Eigenfarbe komplementäre Farbe. Mit diesem Wissen und dem Wissen der additiven Farbmischung läßt sich gut die Entstehung jeder Farbe erklären. Warum erscheint uns ein Gegenstand beispielsweise gelb? Ein Gegenstand erscheint deshalb gelb, weil er weißem Licht, das sich aus roten, grünen und blauen Farbanteilen zusammensetzt, die blauen Farbanteile entzieht. Das Licht besteht nun nur noch aus roten und grünen Farbanteilen. Weil diese gleichzeitig auf die Netzhaut treffen, entsteht durch die additive Farbmischung der Farbeindruck `Gelb'.
Mischt man subtraktiv z.B. Gelb und Purpur, entsteht die Farbe Rot. Erklärung: Die Mischfarbe wird mit weißem Licht beleuchtet, das alle Farben enthält. Die gelben Pigmente der Mischfarbe entziehen dem Licht die blauen Farbanteile (Blau ist komplementär zu Gelb). Die purpurnen Pigmente der Mischfarbe entziehen dem Licht die grünen Farbanteile. Da Weiß eine Mischung aus Rot, Grün und Blau ist, Grün und Blau aber von den Farbstoffen geschluckt werden, bleibt nur noch der rote Farbanteil des Lichts übrig. Folglich sehen wir Rot, wenn wir Gelb und Purpur mischen.
Durch Mischung von Gelb (Rot+Grün) und Blaugrün (Blau+Grün) erhält man Grün. Blaugrün (Blau+Grün) und Purpur (Rot+Blau) ergeben Blau. Auf diese Weise kann man durch Mischung der subtraktiven Grundfarben die additiven Grundfarben gewinnen.
4.2.3 Merkmale der Farbe
Jede Farbe weist drei charakteristische Merkmale auf: Farbton, Sättigung und Helligkeit.
Der Farbton ist gleichbedeutend mit dem Namen der Farbe, z.B. Rot, Grün oder Blau.
Die Sättigung wird durch Beimischung von Weiß, Grau oder Schwarz bestimmt. Dabei wird die Leuchtkraft der Farbe geändert. Je mehr Weiß in ihr enthalten ist, desto weniger Leuchtkraft besitzt sie.
Die Helligkeit einer Farbe wird durch die Lichtmenge bestimmt, die sie reflektiert, und ist eine rein meßtechnische Größe: Sie beschreibt das Verhältnis der Leuchtdichte einer Farbe zur Leuchtdichte eines reinen Weiß. Hellere Farben müssen dem Auge nicht unbedingt als solche erscheinen. Ein leuchtendes Orange kann subjektiv heller als ein helles Grau empfunden werden, obwohl meßtechnisch das Gegenteil zutrifft.
4.2.4 Aufbau des Farbfilms
Abbildung 4.10 zeigt den Aufbau eines Farbnegativ- sowie Farbdiafilms. Beide Filme besitzen drei unterschiedliche Farbschichten in den subtraktiven Grundfarben Gelb, Purpur und Blaugrün. Diese absorbieren die zu ihnen jeweils komplementären Lichtfarben: Die obere Gelbschicht schluckt blaues, die mittlere purpurne grünes und die untere blaugrüne rotes Licht. Die Anordnung der Schichten ist so gewählt, daß das jeweils energiereichere Licht die obenliegende Schicht belichtet. Dadurch wird teilweise verhindert, daß es in tieferliegende Schichten vordringt und sie belichtet, was zu Farbstichen führen würde.
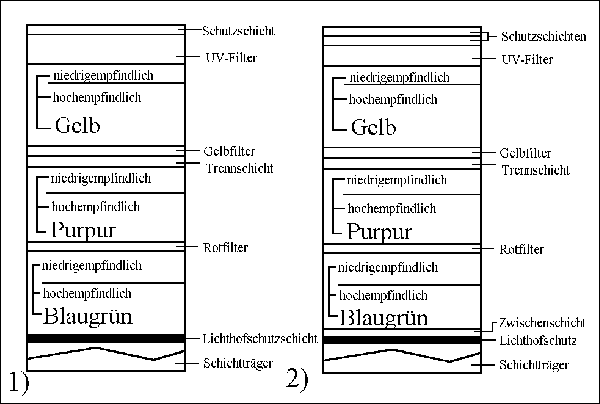
Abbildung
4.10: Schichtaufbau eines Farbfilms. 1) Negativfilm 2) Diafilm
Außer den Silberhalogeniden befinden sich in der Emulsion noch Farbkuppler, die dafür sorgen, daß während der Entwicklung im Film die Farbe in Form von Farbstoffen erzeugt wird. Das Silber wird dabei vollständig entfernt. Es läßt sich jedoch für die Wiederverarbeitung größtenteils rückgewinnen.
Das Bild eines Farbfilms besteht also nicht aus Silber, sondern aus Farbstoffen. Spricht man beim Farbfilm vom Korn, meint man damit Farbstoffe, die sich zusammengeballt haben. Diese sehen unter dem Mikroskop etwas verwaschen aus und werden deshalb auch als Farbstoffwolken bezeichnet.
Beim Negativfilm werden die einzelnen Farbschichten in den Farben ihrer Sensibilisierung entwickelt: Blau, welches die Gelbschicht belichtet hat, erscheint gelb, Grün wird zu Purpur und Rot zu Blaugrün.
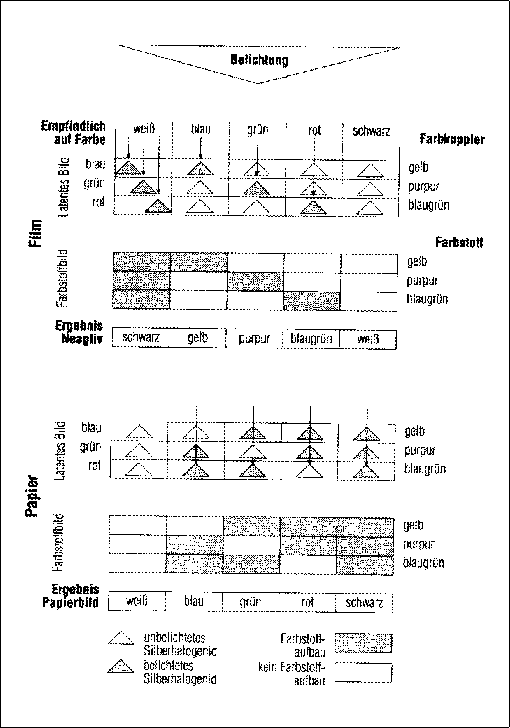
Abbildung
4.11: Bildentstehung beim Farbnegativfilm. Blaues Licht belichtet
die gelbe Schicht, grünes Licht die purpurne und rotes Licht die blaugrüne.
Durch die Entwicklung wird blaues Licht zu Gelb, grünes Licht zu Purpur und
rotes Licht zu Blaugrün. Bei der Papierentwicklung erhält man ein Negativ vom
Negativ, also ein Positiv.
Der Farbschichtenaufbau des Fotopapiers ist identisch mit dem des Negativfilms. Wenn das Negativ auf das Papier belichtet wird, entsteht ein Negativ vom Negativ, also ein Positiv. Abbildung 4.11 zeigt diesen Vorgang etwas ausführlicher.
Im Papierbild entsteht die Farbe `Weiß', wenn beim Negativfilm alle drei Farbschichten vollständig belichtet werden. In der subtraktiven Farbmischung ergeben drei vollständig belichtete Farbschichten Schwarz. Das Negativ ist an diesen Stellen undurchsichtig. Beim Vergrößern erhält das Fotopapier von dort kein Licht und bleibt weiß.
Blaues Licht belichtet die gelbe Negativschicht. Das Negativ wird durch den Vergrößerer mit weißem Licht durchleuchtet. Nach dem Durchgang durch das Negativ ist das Licht gelb. Gelbes Licht belichtet auf dem Fotopapier alle anderen Farbschichten außer Gelb, denn dies ist ja deswegen gelb, weil es die gelben Farbanteile des Lichts reflektiert bzw. hindurchläßt und nicht absorbiert.
Somit werden die purpurne und die blaugrüne Papierschicht belichtet. In der subtraktiven Mischung ergeben Purpur und Blaugrün Blau. Das Fotopapier wird unter weißem Licht betrachtet. Die Purpurschicht entzieht dem weißen Licht die grünen Farbanteile. Die Blaugrünschicht entzieht dem Licht die roten Farbanteile. Übrig bleiben die blauen Lichtanteile.
Grünes Licht belichtet die Purpurschicht des Negativfilms. Das Fotopapier wird deshalb purpur beleuchtet. Alle anderen Farbschichten außer der Purpurschicht werden belichtet; das sind die Gelb- und die Blaugrünschicht. Wird das Fotopapier wieder mit weißem Licht beleuchtet, ergeben die Gelb- und die Blaugrünschicht in der subtraktiven Mischung Grün.
Rotes Licht belichtet die Blaugrünschicht des Negativs. Das Fotopapier wird durch das Negativ mit blaugrünen Licht belichtet. Betroffen davon sind die Gelb- und die Purpurschicht, die in der subtraktiven Mischung wieder rot ergeben.
Schwarze Motivanteile belichten überhaupt keine Negativschicht. An unbelichteten Stellen ist das Negativ durchsichtig. Beim Fotopapier werden alle drei Farbschichten belichtet, die in der Mischung schwarz ergeben.
Der Umkehrfilm (Diafilm) hat den gleichen Schichtaufbau wie der Negativfilm. Auch hier belichtet blaues Licht die obere, grünes die mittlere und rotes die untere Schicht.
Die Schwarzweiß-Umkehrentwicklung erfolgt in zwei Schritten. Zuerst wird eine Negativentwicklung vorgenommen. Dann wird der Film diffus zweitbelichtet. Erst daraufhin erfolgt die Farbentwicklung, bei der die Farben durch Farbstoffe erzeugt werden. Abschließend wird das Silber durch Bleichen aus dem Film entfernt.
Farben entstehen in den Schichten, wo kein Negativbild (Silber) durch die Erstentwicklung entstanden ist, sich also noch Silberhalogenide befinden. Diese werden der Zweitentwicklung unterzogen. Die Farbdichte ist um so größer, je mehr Silberhalogenide sich an einer Filmstelle befinden. (Sie ist proportional zur Schwärzung). Das ist der Fall an dünnen Negativstellen der Erstbelichtung.
Rotes Licht hat die Blaugrünschicht belichtet. Dort entstand ein Negativbild (Silber). Folglich werden Farben in der unbelichteten Purpur- und Gelbschicht gebildet. Beim Durchleuchten mit weißen Licht entzieht die gelbe Schicht (der gelbe Farbstoff) die blauen Farbanteile und die Purpurschicht die grünen Farbanteile. Übrig bleiben die roten Farbanteile des Lichts.
Grünes Licht belichtet die purpurne Schicht. Dort entsteht durch die Negativentwicklung ein Silberbild. Die Gelb- und Blaugrünschicht hingegen werden nicht durch grünes Licht belichtet, weshalb sich dort bei der Zweitentwicklung gelbe und blaugrüne Farbstoffe bilden.
Die gelbe Schicht entzieht dem weißen Licht beim Durchleuchten die blauen Farbanteile. Die blaugrüne Schicht entzieht dem Licht beim Durchleuchten die roten Farbanteile. Weil weißes Licht aus den Farbanteilen Rot, Blau und Grün besteht, aber Blau und Rot entzogen werden ist das Licht danach grün.
Die Entstehung der Farbe Blau darf der Leser selbst nachvollziehen, falls er dazu Lust hat. Das Schema sollte nun deutlich geworden sein.
Weil sich das Bild beim Farbfilm nicht aus Silber, sondern aus Farbstoffen zusammensetzt, gibt es für ihn auch keine Schwärzungskurven, sondern Farbdichtekurven. Sie zeigen genauso wie die Schwärzungskurve den Einfluß der Belichtung auf die Filmschicht. Dabei entstehen drei Dichtekurven, für jede Farbschicht eine. Die Kurven beschreiben die Intensität der jeweiligen Farben in Form von Lichtundurchlässigkeit (Dichte), die durch unterschiedlich helles Licht verursacht wird.
Abbildung 4.12 zeigt die Farbdichtekurven eines Negativ- sowie Diafilms. Beim Diafilm verlaufen die Kurven umgekehrt. Schließlich soll wenig Licht eine hohe Dichte verursachen, damit auf dem Dia dunkle Motivstellen auch dunkel sind. Helle Motivstellen dürfen im Dia nur geringe Deckung erzeugen, um hell zu erscheinen.
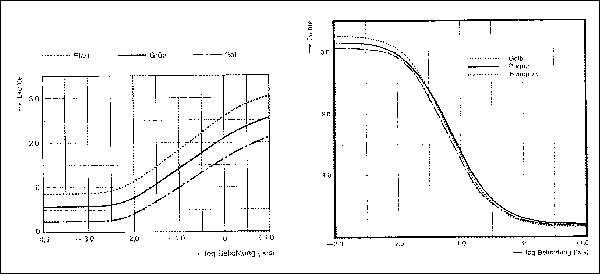
Abbildung
4.12: Farbdichtekurven. 1. Negativfilm (Agfacolor XRG 100,
links). 2. Diafilm (Agfachrome 50 RS Professional, rechts). Damit das Motiv
ohne Farbstiche abgebildet wird, müssen die Kurven parallel verlaufen.
Wenn die Farbwiedergabe ausgeglichen sein soll und keine Farbstiche entstehen sollen, müssen alle drei Kurven parallel verlaufen. Sie sollten sogar möglichst deckungsgleich sein. Wenn eine Dichtekurve nach oben verschoben ist, aber ansonsten parallel zu den anderen Kurven verläuft, ergibt sich ein Farbstich mit gleichmäßiger Dichte, der bei Negativfilmen während des Vergrößerns ausgefiltert werden kann.
Liegt z.B. die Gelbkurve oberhalb der Purpur- und Blaugrünkurve, so bedeutet dies, daß blaues Licht einen verhältnismäßig stärkeren Belichtungseindruck hinterläßt. Das Negativ ist dann `gelber'. Damit das Fotopapier nicht mit zuviel gelben Licht belichtet wird, filtert man es beim Vergrößern mit einen Blaufilter geeigneter Dichte wieder aus. Andernfalls würde das Papierbild blaustichig. Beim Filtern von Farbstichen bei Negativfilmen gilt die Regel: Ein Farbstich auf dem Papierbild wird immer mit einen gleichfarbigen Filter ausgefiltert.
Die Filter von Vergrößerungsgeräten bestehen ebenfalls aus den subtraktiven Grundfarben Gelb, Purpur und Blaugrün. Um ein blaues Filter zu erhalten, kombiniert man ein Purpurfilter mit einen Blaugrünfilter.
Wenn sich die Farbdichtekurven überschneiden, kommt es zu einen kippenden Farbgang, zum Farbkippen. In Abbildung 4.13 verläuft die rotempfindliche Blaugrünkurve bei schwacher Belichtung oberhalb der beiden anderen Farbdichtekurven. Bei stärkerer Belichtung verläuft die Blaugrünkurve unterhalb der Gelb- und der Purpurkurve.
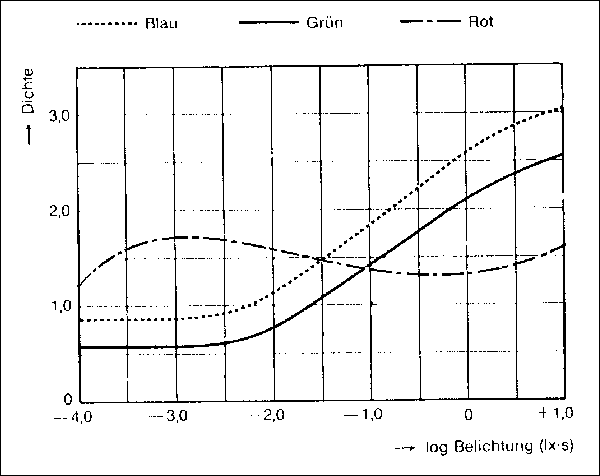
Abbildung
4.13: Farbkippen. Die rotempfindliche Blaugrünkurve verläuft bei
schwachen Licht oberhalb, bei starken Licht unterhalb der anderen
Farbdichtekurven. Das hat zur Folge, daß dunkle Motivstellen im Papierbild
einen Rotstich und helle Motivstellen einen Blaugrünstich aufweisen. Filtert
man den Rotsich aus, verstärkt sich der Blaugrünstich und umgekehrt.
Bei schwacher Belichtung dominiert so im Negativ die Farbe Blaugrün, die auf dem Papierbild als Rot erscheint. Bei starker Belichtung dominiert die Mischfarbe aus Gelb und Purpur (Farbstoffe der beiden anderen Farbdichtekurven), also Rot. Rot erscheint im Positiv als Blaugrün. Auf dem Papierbild weisen deshalb dunkle Bildstellen einen Rotstich und helle Bildstellen einen Blaugrünstich auf. Beim Diafilm würde genau das Gegenteil zutreffen: Ein Blaugrünstich in den Schatten (dunkle Bildstellen) und ein Rotstich in den Lichtern (helle Bildstellen).
Beim kippenden Farbgang entsteht ein komplementärer Farbstich (Rot und Blaugrün sind Komplementärfarben), der nicht ausgefiltert werden kann. Um den Farbstich in den Schatten auszufiltern, benötigt man ein Filter in der Komplementärfarbe (Diafilm). Damit verstärkt man jedoch den Farbstich in den Lichtern. Gleiches gilt für den Negativfilm, nur daß dort Farbstiche mit Filtern gleicher Farbe ausgefiltert werden.
Beim genauen Betrachten eines Negativfilms stellt man fest, daß er einen orangefarbigen Überzug hat. Die Farbe kommt von zwei Masken, einer roten und einer gelben. Sie sorgen für reinere und brillantere Farben. Manche Filme haben auch drei Masken. Warum genau braucht man Masken und wie funktionieren diese? Folgende Absätze gehen auf diese Frage ein:
Wenn der Farbfilm oder das Papierbild entwickelt ist, bestehen beide aus drei unterschiedlichen Farbschichten: Gelb, Purpur und Blaugrün. Diese Farbschichten haben die Aufgabe, dem weißen Licht, mit dem das Bild betrachtet wird, gewisse Farbanteile zu entziehen. Dabei soll jede Farbschicht aus dem weißen Licht den zu ihr komplementären Farbanteil `herausziehen'. Alle anderen Farbanteile sollen reflektiert oder hindurchgelassen werden, also unbeeinträchtigt bleiben. Die Gelbschicht dürfte also nur Blau, die Purpurschicht nur Grün und die Blaugrünschicht nur rotes Licht absorbieren.
In Wirklichkeit absorbieren die Farbschichten aber auch Licht, für das sie eigentlich nicht empfindlich sein dürften. Besonders davon betroffen sind die Purpur- und die Blaugrünschicht. Die Purpurschicht schluckt einen Teil des blauen Lichts weg und nicht nur Grün. Das hat zur Folge, daß sie gelblich erscheint, weil dem Licht nun ein gewisser Blauanteil (Komplementärfarbe zu Gelb) fehlt, der dieses gelbliche Licht `filtern' würde. Man spricht hier von einer (gelben) Nebendichte, welche die Reinheit der Farbwiedergabe verschlechtert.
Abbildung 4.14 verdeutlicht anhand des Agfachrome 50 RS Professional das Absorptionsvermögen der Schichtfarbstoffe. Man kann erkennen, daß die einzelnen Farbstoffe zwar für ihre Komplementärfarben maximal empfindlich sind, aber auch in geringerem Maße für ihre Nachbarfarben. Die Purpurschicht z.B. ist nicht nur für grünes, sondern auch blaues Licht empfindlich.
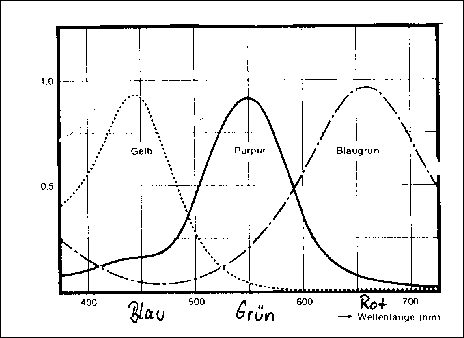
Abbildung: Absorptionsvermögen
der Schichtfarbstoffe. Die Farbstoffe eines Films absorbieren nicht nur
Licht der Komplementärfarbe, sondern auch Licht, das nur ihre Nachbarfarbe
absorbieren soll. Die sogenannten Nebendichten führen zu nicht mehr
korrigierbaren Farbstichen. Sie können beim Negativfilm jedoch durch Masken
kompensiert werden.
Die blaugrüne Schicht absorbiert grünes und sogar blaues Licht. Weniger grünes Licht läßt Purpur stärker dominieren und weniger blaues Licht `verstärkt' Gelb. Die Blaugrünschicht weist deshalb ein rötliche Nebendichte (Gelb + Purpur) auf.
Im folgenden sollen die Auswirkungen bis auf je ein Beispiel für den Dia- und den Negativfilm nicht detailliert ausgeführt, sondern lediglich aufgezählt werden. Der interessierte Leser kann sich mit Hilfe der bisherigen Kenntnisse die Auswirkungen herleiten.
Beim Farbdiafilm wirken sich Nebendichten nicht so störend aus. Die gelbe Nebendichte des Purpurfarbstoffes filtert einen Teil des blauen Lichtes heraus. Dadurch erscheint Blau verschwärzlicht. Das gleiche gilt für Grün (rötliche Nebendichte filtert Grün). Purpurfarben erscheinen weniger blau. Insgesamt werden die Farbtöne nicht wesentlich verändert.
Schlechter sieht es für den Negativfarbfilm aus. Die Purpurschicht des Negativfilms erzeugt im Papierbild durch Belichten der Gelb- und Blaugrünschicht die Farbe Grün. Beim Durchleuchten des Negativs wird dem Vergrößererlicht aber mehr Blau entzogen als notwendig wäre. Dadurch wird die Gelbschicht des Fotopapiers weniger belichtet. Beim Betrachten des Fotopapiers wird dem Betrachtungslicht weniger Blau entzogen, weil die Gelbschicht des Fotopapiers weniger Dichte aufweist. Somit ist das Grün blaustichig.
Rot erscheint gelbstichig. Blau, Gelb und Purpur weisen eine geringere Farbsättigung auf.
Nebendichten lassen sich nicht durch eine einheitliche Filterung korrigieren. An dichten Negativstellen sind mehr Nebendichten vorhanden als an weniger dichten Stellen. Ein Filter jedoch filtert an allen Stellen mit der gleichen Dichte. Abhilfe schaffen Masken. Sie sind an dichten Stellen weniger dicht und an nicht so dichten Negativstellen dichter. Dabei entsteht ein einheitlicher Farbstich gleicher Dichte in den Farben der Nebendichten, der sich ausfiltern läßt.
Für die Purpurschicht verwendet man eine gelbe, für die Blaugrünschicht eine rötliche Maske. Beide Masken ergeben die typische farbige Tönung des Farbnegativfilm-Schichtträgers.
Eine besondere Sensibilisierung weist der Infrarotfarbfilm auf. Wie der Schwarzweiß-Infrarotfilm zeichnet er für das menschliche Auge unsichtbares, infrarotes (lat. infra = nahebei) Licht zwischen 700 und 900 nm auf. Aufgrund seiner ungewohnten Farbwiedergabe ist er für `kreative Fotografen' besonders interessant. Man sollte dabei Gelb-, Orange-, Rot- oder Infrarotfilter einsetzen. Auch hier ist es wie beim Schwarzweiß-Infrarotfilm ratsam, vorher das Datenblatt des Filmherstellers genau zu studieren. In der Wissenschaft werden Infrarotfarbfilme zur Erkennung von Baumschädigungen verwendet. Gesunde Bäume erscheinen rot, geschädigte werden blasser wiedergegeben.
4.3 Weitere Eigenschaften der Filme
Filme haben noch zahlreiche weitere Eigenschaften, zu denen die sogenannten Effekte zählen. Hier sollen vier erörtert werden, die in der Praxis des Fotografen von besonderer Bedeutung sind oder häufiger in Fachzeitschriften genannt werden: Der Kanten-, der Interimage-, der Schwarzschild- und der Ultrakurzzeiteffekt.
Beim Kanteneffekt werden während der Entwicklung an den Grenzen zwischen schwach belichteten und stark belichteten Stellen die Kanten stärker geschwärzt. Das geschieht, weil der Entwickler die benachbarten, weniger geschwärzten Stellen schwächer entwickelt, als es dem Belichtungseindruck entspricht, weil er von den stärker belichteten Stellen rascher verbraucht wird. Der Kanteneffekt führt zur Erhöhung der Bildschärfe.
Der Interimage-Effekt entsteht beim Farbfilm und ist mit dem Kanteneffekt verwandt. Er bewirkt eine Steigerung der Farbsättigung, ohne daß Gesamtkontrast und Belichtungsspielraum beeinträchtigt werden. Der schärfesteigernde Kanteneffekt wird bei Farbfilmen durch DIR (development inhibitor release)-Kuppler erreicht, die während der Entwicklung die Bildung weiteren Silbers in der Nachbarschaft stark belichteter Stellen verhindern.
Bei Langzeitbelichtungen tritt der Schwarzschildeffekt, benannt nach dessen Entdecker, auf. Innerhalb üblicher Belichtungszeiten, etwa zwischen 1 / 1000 und 1 Sekunde, gilt, daß es egal ist, ob man mit einer kurzen Verschlußzeit und einer großen Blende oder mit einer langen Verschlußzeit und einer kleinen Blende fotografiert. Die Blende regelt die Lichtmenge, der Verschluß die Belichtungszeit.
Solange das Produkt aus Lichtmenge mal Zeit gleich groß ist, erzielt man innerhalb dieser Grenzen die gleiche Filmschwärzung. Bei längeren Belichtungszeiten, über 1 Sekunde, bei manchen Filmmaterialien bereits ab 1/2 Sekunde, wird der Film nicht mehr proportional zur Belichtungszeit geschwärzt, sondern schwächer. Einfach ausgedrückt, verringert der Schwarzschildeffekt die Filmempfindlichkeit.
Das Resultat ist bei üblicher Belichtung eine Unterbelichtung; das Bild erscheint zu dunkel. Folglich muß man länger belichten, als der Belichtungsmesser anzeigt. Inwieweit man korrigieren muß, hängt vom Film ab. Filmhersteller liefern zu ihren Filmen Datenblätter, denen die genauen Werte entnommen werden können. So muß z.B. der Agfapan 25 zwei Sekunden belichtet werden, wenn der Belichtungsmesser eine Sekunde anzeigt. Bei 100 Sekunden Belichtungsmesseranzeige muß 400 Sekunden belichtet werden.
Die einzelnen Farbschichten von Farbfilmen reagieren unterschiedlich auf den Schwarzschildeffekt. Deshalb entsteht zusätzlich zur Unterbelichtung ein gelber bis gelbgrüner Farbstich, der ausgefiltert werden kann. Auch hierzu nennen die Filmhersteller in Datenblättern die erforderlichen Filter.
Der Ultrakurzzeiteffekt tritt bei sehr kurzen Belichtungszeiten auf. Ebenso wie beim Schwarzschildeffekt führt das zur Unterbelichtung und Farbstichen. Korrekturwerte und -Filter sind den Filmdatenblättern zu entnehmen.
4.4 Leistungsmerkmale eines Films
Die Leistungsmerkmale eines Films sind Schärfe, Empfindlichkeit und Feinkörnigkeit. Beim Farbfilm kommt noch die Farbwiedergabe hinzu.
Schärfe. Schärfe ist kein einheitlich definierter Begriff. Hier soll auch nicht detailliert darauf eingegangen werden, weil das im Kapitel `Schärfe' erfolgt. Im allgemeinen ist ein Film um so schärfer, je feinkörniger er ist. Schließlich lassen sich mit kleinen Körnern (`Mosaiksteinchen') kleinere Details darstellen als mit großen. In bestimmten Fällen können jedoch auch etwas grobkörnigere Filme schärfer sein.
Das liegt am sogenannten Diffusionslichthof: Die Körner reflektieren (streuen) Licht auf die Nachbarkörner und belichten diese. So wird für eine Belichtung gesorgt, die nicht durch ein Motivdetail erfolgte. Dabei verringert sich die Schärfe. Größere Körner können manchmal einen geringeren Diffusionslichthof verursachen und somit eine bessere Auflösung besitzen.
Die Schärfe eines Films überprüft man unter einer guten Lupe mit mindestens 8-facher Vergrößerung an den Kanten von abgebildeten Gegenständen. Am besten eignen sich scharfe Linien vor dunklem Hintergrund. Das kann beispielsweise ein Fensterkreuz sein. Wirklich gute Lupen haben allerdings ihren Preis; man muß dafür zwischen 200 bis 300 DM investieren.
Empfindlichkeit. Je höher die Filmempfindlichkeit ist, desto weniger Licht benötigt man für eine Aufnahme. Es ist dann selbst bei schlechten Lichtverhältnissen möglich, frei aus der Hand zu fotografieren. Die Empfindlichkeit kann durch Einlagerung von mehr oder größeren Körnern in die Emulsion gesteigert werden. Dabei verschlechtert sich jedoch die Schärfe: Wenn die Körner größer sind, lassen sich nicht so feine Details darstellen und es entsteht bei Flächen der Eindruck von Körnigkeit. Mehr Körner wiederum vergrößern den Diffusionslichthof.
Feinkörnigkeit. Setzt man Schärfe und Empfindlichkeit in Beziehung, gilt, daß Feinkörnigkeit zwar schärfefördernd, aber empfindlichkeitsvermindernd wirkt. Filme können entweder feinkörnig oder sehr lichtempfindlich sein. Beides gleichzeitig ist nicht möglich.
Farbwiedergabe. Die Qualität der Farbwiedergabe ist an folgenden drei Kriterien zu überprüfen: Farbsättigung, Farbtontrennung und Graubalance.
Die Farbsättigung (auch Leuchtkraft, Intensität, Brillanz, Reinheit) besagt, wie intensiv eine Farbe wiedergegeben wird, wie groß ihre Leuchtkraft ist. Je stärker die Farbsättigung ist, desto besser werden auch blasse Motive mit hellen, schwachen Farben wiedergegeben. Motive erscheinen besonders dann blaß, wenn die Beleuchtung schwach ist. Das ist beispielsweise bei stark bewölkten Himmel, bei Nebel oder in schwach beleuchteten Innenräumen der Fall. Filme mit geringer Farbsättigung geben derartige Motive blaß, fast farblos wieder. Dort wurde ebenfalls der Begriff Farbton erklärt, der bedeutungsgleich mit dem Namen der Farbe ist.
Die Farbtontrennung (auch Farbtondifferenzierung, Farbtontreue) besagt, ob eng beieinanderliegende Farbtöne noch differenziert wiedergegeben werden können. So sollte ein Blau, das etwas ins Purpur tendiert, auch von einem reinen Blau unterschieden werden können. Filme mit schlechter Farbtondifferenzierung würden geringe Farbunterschiede nicht registrieren, sondern diese als einheitliche Farbe wiedergeben. Im schlimmsten Fall erscheint eine Farbe falsch. So fotografierte ich einmal ein rotes Plakat, das auf einem bestimmten Diafilm orange erschien. Weil das im Rahmen eines Filmtests geschah und die anderen drei Filme das Plakat rot zeigten, war die Beleuchtung nicht dafür verantwortlich, sondern vielmehr die schlechte Farbwiedergabe des Films.
Schwarz, Weiß und Grau sind unbunte Farben. Im Gegensatz dazu sind alle anderen Farben bunte Farben, z.B. Blau oder Rot. Bei Farbfilmen werden alle Farben durch die drei Farbschichten Gelb, Blaugrün und Purpur dargestellt. Das trifft auch für die Grautöne zu. Es ist nicht ganz einfach, Grauwerte ohne Farbstich aufzuzeichnen. Zudem erkennt der Mensch Farbstiche im Grau relativ leicht. Ein Film mit guter Graubalance verhindert bei richtiger Beleuchtung solche Farbstiche. Dazu müssen die drei Farbschichten genau aufeinander abgestimmt sein.
Technische Fortschritte. Wenn man eines der vier Leistungsmerkmale verbessert, so verschlechtert sich zwangsweise mindestens ein anderes. Man kann die Filmempfindlichkeit erhöhen, erkauft damit aber eine stärkere Körnigkeit oder geringere Schärfe. Verbessert man Körnigkeit bzw. Schärfe, so geht das zu Lasten der Empfindlichkeit.
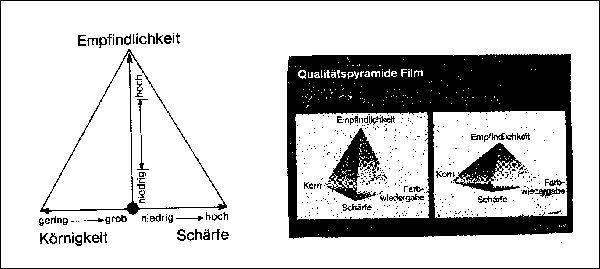
Abbildung
4.15: Leistungsdreieck und Leistungspyramide eines Films. Wenn man
eine der Seiten verlängert und damit eine Filmeigenschaft verbessert, so
verkürzen sich zwangsweise die anderen Seiten und damit verschlechtern sich
andere Filmeigenschaften, weil Fläche bzw. Volumen gleichbleiben müssen. Welche
der Eigenschaften verbessert und welche verschlechtert werden, hängt vom
Anwendungsbereich des Films ab.
Diesen Zusammenhang verdeutlichen das Leistungsdreieck oder die Leistungspyramide eines Films. Abbildung 4.15 zeigt beide Varianten. Die Fläche beim Dreieck oder das Volumen bei der Pyramide müssen gleich bleiben. Die Verbesserung eines Faktors hat zwangsweise die Verschlechterung eines anderen zur Folge. Vergrößert man beispielsweise die Höhe der Leistungspyramide und damit die Filmempfindlichkeit, so kann sich die Farbwiedergabe, die Feinkörnigkeit oder die Schärfe verschlechtern.
Welche Eigenschaften verbessert oder verschlechtert werden, hängt vom Anwendungsbereich des Filmes ab. Ein niedrigempfindlicher, feinkörniger und scharfer Film liefert mit Sicherheit schlechte, unscharfe Bilder, wenn der Fotograf aufgrund zu langer Verschlußzeiten alle Bilder verwackelt. Ein hochempfindlicher Film liefert da zwar nicht die Schärfe und Farbbrillanz des niedrigempfindlichen, aber dafür unverwackelte brauchbare Fotos.
Es gibt einige Motive, wo eher eine kräftige Farbwiedergabe, andere, bei denen besser eine dezente Farbwiedergabe erwünscht ist. Will man beispielsweise die Leuchtkraft des Herbstes voll zur Geltung bringen, ist ein Film mit kräftiger Farbwiedergabe am geeignetsten. Bei Porträtaufnahmen hingegen ist ein Film mit dezenter Farbwiedergabe besser, damit die Hautfarbe möglichst natürlich erscheint. So bietet Agfa eine Filmserie, das Triade-System, an, die Farben unterschiedlich kräftig wiedergibt. Auch Kodak hat für Porträts einen speziellen Film im Sortiment, den Vericolor 400, ebenso Konica, der dort Baby-Film heißt.
Durch eine technische Weiterentwicklung können Fläche bzw. Leistungsvolumen verbessert werden. Gegenüber der bisherigen Emulsionstechnik ist es dann möglich, bei höherer Empfindlichkeit gleichzeitig eine höhere Farbsättigung sowie Feinkörnigkeit zu erreichen. Durch die Verbesserung vergrößern sich Fläche und Volumen des Leistungsdreiecks bzw. der Leistungspyramide. Derartige Fortschritte werden beispielsweise durch neue, regelmäßigere Kristalle mit größerer Oberfläche, dünnere Filmschichten oder andere Sensibilisierungsstoffe erzielt.
4.5 Weitere Spezialfilme
Neben Infrarotfilmen und Filmen mit unterschiedlicher Farbsättigung befinden sich noch weitere Spezialfilme auf dem Markt. Außerdem ist das Angebot in Amateur- und Profifilme aufgeteilt.
Farbfilme sind meistens auf Tageslicht- oder Blitzlichtbeleuchtung abgestimmt. Weicht die spektrale Zusammensetzung der Lichtquelle davon ab, registriert der Film das und bekommt einen Farbstich. Die Farben sehen auf den Bildern dann unnatürlich aus, wie durch ein Filter in der Farbe des Farbstiches betrachtet. Fotografiert man z.B. mit Tageslichtfilmen bei Glühlampenlicht, erhalten die Filme einen gelb-rötlichen Farbstich. Farbstiche können bei Negativfilmen während des Vergrößerns herausgefiltert werden; bei Diafilmen nicht, denn diese werden direkt betrachtet.
Durch den Einsatz von Kunstlichtfilmen kann ein Farbstich bei Glühlampenlicht vermieden werden. Als Beleuchtung verwendet man am besten spezielle auf die Filme abgestimmte Fotolampen. Man kann zwar Tageslichtfilme auch bei Kunstlicht verwenden, wenn ein Blaufilter vor das Objektiv gesetzt wird, erzielt damit aber nicht die Farbwiedergabequalität von Kunstlichtfilmen. Außerdem schlucken Filter Licht, und das ist bei künstlicher Beleuchtung ohnehin knapp. Farbdiafilme werden häufiger für Kunstlicht angeboten als Farbnegativfilme.
Der Diaduplizierfilm von Agfa, Kodak oder Fuji wird, wie es sein Name verrät, speziell für das Duplizieren von Dias, dem Herstellen einer Kopie, eingesetzt. Von Kodak gibt es einen Duplizierfilm für Tageslicht bzw. Blitzlicht. Dieselbe Firma und die anderen liefern ihn ansonsten nur für Kunstlicht. Diafilme haben eine relativ steile Gradation, arbeiten also hart. Wenn diese mit herkömmlichen Diafilmen dupliziert werden, verstärken sich die Kontraste, die Duplikate werden extrem hart und weisen sowohl in sehr hellen als auch dunklen Bildstellen kaum noch Motivdetails (Zeichnung) auf. Sie sind dort dann weiß oder schwarz. Um das zu vermeiden, arbeitet der Diaduplizierfilm mit flacher Gradation. Allerdings muß man spezielle Farbfilter vor die Lichtquelle setzen, um eine möglichst farbgetreue Wiedergabe zu erreichen. Die Technik des Diaduplizierens wird später behandelt.
Für Unterwasserfotografen liefert Kodak einen speziellen Unterwasserdiafilm, der eine erhöhte Rotempfindlichkeit aufweist. Das Wasser schluckt die energieärmeren Rotanteile des Lichts stark, so daß alle Aufnahmen in bereits geringen Wassertiefen einen Blaustich bekommen. Dem wirkt der Unterwasserfilm entgegen.
Dokumentenfilme besitzen eine sehr niedrige Empfindlichkeit und arbeiten aufgrund ihrer steilen Gradation sehr hart. Sie stellen alles ohne Grautöne nur in Schwarz und Weiß dar. Außer zu kreativen Zwecken in der bildmäßigen Fotografie
werden sie praktisch nur für die Mikroverfilmung von Dokumenten verwendet.
Lithfilme haben eine noch steilere Gradation und höchste Maximaldichte. Ihr Einsatzgebiet sind Strich- und Rasteraufnahmen bei der Reprofotografie. Außerdem eignen sie sich auch hervorragend für Schrifttitelaufnahmen in Diaschauen. Die Entwicklung von Dokumenten- und Lithfilmen erfolgt in speziellen Entwicklern, z.B. Dokumol oder Dokulith von der Firma Tetenal.
Bekannte Hersteller liefern meist zwei Filmsortimente aus: Amateurfilme und Profifilme. Letztere tragen üblicherweise die Bezeichnung `Professional' im Namen. In Fotozeitschriften wird häufig die Frage gestellt, ob Profifilme besser als Amateurfilme sind.
Das kann man nicht generell mit `Ja' beantworten. Profifilme unterscheiden sich von den Amateurversionen hauptsächlich in den Fertigungstoleranzen und der Lagerung. Bei Profifilmen sind die Fertigungstoleranzen grundsätzlich geringer als bei Amateurfilmen. Abweichungen in der Lichtempfindlichkeit und Farbtemperatur bei unterschiedlichen Produktionsgängen sind bei Profifilmen geringer als bei Amateurfilmen. So betragen die erlaubten Maximalabweichungen bei Agfa-Profifilmen in der Empfindlichkeit 0,5 DIN, das sind 0,05 Dichteeinheiten. Farbabweichungen dürfen im Bereich von Plus/Minus 5 Filtereinheiten liegen, was ebenfalls 0,05 Dichteeinheiten Entspricht.
Profifilme werden im optimalen Zustand ausgeliefert und sind für die Kühlschranklagerung vorgesehen, damit sie ihre Eigenschaften beibehalten. Amateurfilme hingegen werden bei Zimmertemperatur um +20 C aufbewahrt. Sie erreichen ihre optimalen Eigenschaften oft erst nach einer gewissen Lagerdauer. Die Lagerung von Filmen wird noch ausführlicher besprochen.
Tips für die Filmauswahl
Welchen Markenfilm man bevorzugen sollte, ist vorwiegend Geschmackssache. Bezüglich Schärfe und Feinkörnigkeit unterscheiden sich Filme der gleichen Empfindlichkeit eigentlich nur noch im Testlabor. Deshalb dürfte die Auswahl hauptsächlich durch die Farbwiedergabe beeinflußt werden. Der Leser kann Filme nach folgenden Methoden testen, um den für ihn besten Film zu finden. In der Regel ist ein Test nur sinnvoll, wenn man Filme gleicher Empfindlichkeit miteinander vergleicht.
Man fotografiert bei Tageslicht oder mit Blitzlicht eine Farbtafel mit Grauskala, z.B. von Kodak. Die Auswertung der Dias bezüglich der Farbwiedergabe erfolgt auf einem Leuchtpult mit Tageslichtcharakter. Dabei vergleicht man die Originalfarben und Grauabstufungen der Farbtafel bzw. Grauskala mit deren Wiedergabe auf dem Film. Das Licht, mit dem die Tafeln beim Vergleich beleuchtet werden, muß natürlich mit dem des Leuchtpults, auf dem der Film betrachtet wird, identisch sein. Der Praxis eines Amateurs eher entgegenkommend dürfte folgende sehr aufwendige Methode sein:
Man legt verschiedene Filme gleicher Empfindlichkeit in unterschiedliche Kameragehäuse mit gleichen Objektivanschluß ein und fotografiert die unterschiedlichsten Motive. Weil wohl die wenigsten Leser viele Kameragehäuse besitzen dürften, ist das eine mögliche Aufgabe für einen Fotoclub. Sicherlich haben auch andere Mitglieder Interesse an so einen Test, vielleicht in `abgeschwächterer' Form, als er im folgenden beschrieben wird.
Man sollte während des Tests an allen Gehäusen stets dasselbe Objektiv verwenden, weil auch gleiche Objektive Produktionsschwankungen aufweisen können. Eine vorherige Kontrolle und gegebenenfalls Justierung der Verschlußzeiten aller Kameragehäuse durch den Kundendienst der Kamerahersteller ist erforderlich, wenn der Test objektiv sein soll. Anderenfalls würde das Belichtungsergebnis verfälscht. Abweichungen in der Belichtung bedeuten zwangsläufig Abweichungen in der Helligkeits- und Farbwiedergabe.
Die Belichtung muß manuell eingestellt werden, damit die Automatik hier nicht nach Gutdünken reagiert. Das heißt, bei allen Kameras wird beim gleichen Motiv die gleiche Verschlußzeit und die gleiche Objektivblende eingestellt.
Für jede Aufnahme wird ein Stativ verwendet, das beim selben Motiv in der gleichen Weise aufgestellt bleibt. Damit ist der gleiche Motivausschnitt gewährleistet und die Verwacklungsgefahr ist geringer.
Ein Tag, an dem die Lichtbedingungen immer wieder wechseln, weil häufiger Wolken vor die Sonne ziehen, eignet sich weniger gut, weil unterschiedliche Beleuchtung zwangsläufig zu anderer Farbwiedergabe führt, selbst beim gleichen Film. Zumindest innerhalb des gleichen Motivs sollte die Beleuchtung stets gleich sein. Am besten eignet sich ein Tag mit Sonnenschein und ein paar kleinen Wolken am Himmel.
Bei der Motivauswahl sollten kontrastreiche Motive ebenso vertreten sein, um den Belichtungsumfang der Filme zu vergleichen, wie bunte und monochrome (einfarbige) Motive, die zum Test der Farbwiedergabe herangezogen werden.
Die Filme müssen auf jeden Fall von einen Profidienst entwickelt werden. Häufig sind Farbstiche und leichte Fehlbelichtung nämlich auf schlampige Entwicklung seitens des Labors zurückzuführen.
Zugegeben, eben aufgeführter Test ist sehr aufwendig. Aber das muß er sein, damit Objektivität gewährleistet ist. Ich weiß allerdings noch von keinen Fotoclub, welcher Diafilme einmal so aufwendig getestet hat. Neben einer Menge Arbeit sind auch die Kosten nicht unerheblich: Prüfung und Justage der Verschlußzeiten durch einen guten Kameraservice, teure Filmentwicklungskosten durch einen Profiservice.
Und was nützt so ein Test letztlich? Wer seinen Film nach wie vor im Billiglabor entwickeln läßt, dem sind keine kontinuierlich einwandfreien Resultate garantiert und spätestens in zwei Jahren gibt es neue Filme, welche die alten ablösen. Zudem entscheidet das Filmmaterial kaum die Beurteilung eines Fotos. Ein guter Fotograf findet selbst beim Einsatz `schlechtester' Filme Akzeptanz für seine Bilder. Ein unbegabter Fotograf wird auch mit den besten Film keine besseren Bilder zustandebringen.
Wer also diesen Aufwand nicht betreiben will, aber trotzdem `seinen' Film noch sucht, fotografiert einfach einmal bei Gelegenheit mit unterschiedlichen Filmmarken und entscheidet nach Gefühl. Weitere Anhaltspunkte zum Filmtest oder zur Filmauswahl allgemein liefern Filmtests in Fachzeitschriften.
Bei Negativfilmtests ist allerdings zu berücksichtigen, daß die Papierbildentwicklung von Labor zu Labor oft völlig unterschiedlich ausfallen kann. Ursache dafür sind die unterschiedlichen Filter- und Belichtungseinstellungen an den Vergrößerungsgeräten, welche in der Regel automatisch erfolgen. Weiteren Einfluß üben die Sorte des Vergrößerungspapiers, die Entwicklungschemikalien und die Art der Verarbeitung aus.
Selbst das gleiche Labor liefert oft unterschiedliche Abzüge vom selben Negativ. Die richtige Helligkeit und Farbwiedergabe eines Bildes ist innerhalb gewisser Grenzen durchaus Ermessenssache des jeweiligen Betrachters, hier des Laboranten. Deshalb sollte man bei weiteren Bestellungen das Papierbild als Vorlage mit einreichen, wenn die Abzüge genauso wie dieses aussehen sollen. Jeder Negativfilm, den man testet, sollte in dem Labor entwickelt und vergrößert werden, dem man auch sonst seine Filme überläßt.
Bei der Suche eines Labors, von dem man zukünftig alle Bilder entwickeln lassen will, kann es hilfreich sein, das gleiche Negativ von verschiedenen Labors vergrößern zu lassen und die Abzüge zu vergleichen. Am besten fotografiert man zu diesen Zweck gleich mehrere Negative vom Stativ, z.B. eines mit vielen Details, um die Schärfe der Vergrößerungen zu prüfen. Für einen Test der Fehlerkorrektur fotografiert man Bilder mit absichtlichen Farbstich, z.B. eine Kunstlichtaufnahme mit Tageslichtfilm, ein um zwei Blenden unter- sowie überbelichtetes Negativ. Die Farbwiedergabe läßt sich gut mit dem Foto einer Farbtafel oder mit bunten sowie monochromen Motiven testen. Die Farbtafel läßt sich auch selbst herstellen: Man klebt auf einen DIN A 3-Karton schwarze, graue, weiße und verschiedenfarbige Papierstreifen.
Gelegentlich wird auch die Frage gestellt, ob man besser mit Dia- oder Negativfilmen fotografieren soll. Die Antwort ist einfach: Wer als Endprodukt Papierbilder haben will, der fotografiert mit Negativfilm. Der Diafilm ist besser geeignet, wenn viele Betrachter das gleiche Bild sehen sollen. Außerdem zieht ein im dunklen Raum gezeigtes Foto die Aufmerksamkeit der Betrachter viel mehr auf sich - ganz zu schweigen von der beeindruckenden Bildgröße auf der Leinwand. Man kann zwar Papierabzüge von Diafilmen herstellen. Diese sind jedoch nie so gut wie Negativabzüge. Das liegt an der steileren Gradation und dem stärkeren Kontrast der Diafilme.
Vergleichen Sie hierzu einmal beide Farbdichtekurven auf Seite. Dort ist deutlich zu erkennen, daß die Kurve des Diafilms steiler als die des Negativfilms ist. Insbesondere bei kontrastreichen Motiven gehen oft im Dia noch erkennbare Details in hellen und dunklen Bildstellen auf dem Papierfoto verloren.
Neuerdings kann man jedoch mit dem Agfa Digital Print-Verfahren bessere Ergebnisse als bisher erzielen. Die meisten Fachgeschäfte bieten es an. Eine Beschreibung dieses Verfahrens finden Sie auf Seite. Filmnamen die mit -color enden, bezeichnen einen Negativfilm, -chrome verweist auf einen Diafilm.
Der Diafilm eignet sich auch bestens für Versuche, weil das Ergebnis durch kein Labor verändert wird. Man erkennt Fehlbelichtungen sofort. Gezielte Farbfilterungen werden nicht durch ein Labor als vermeintliche Farbstiche wieder weggefiltert. Allerdings können auch hier von Labor zu Labor geringe Farbunterschiede beim gleichen Film auftreten.
Der Diafilm ist wesentlich kostengünstiger, sieht man einmal von den einmaligen Anschaffungskosten eines Diaprojektors plus Leinwand ab. Teuer wird der Negativfilm hauptsächlich durch die Vergrößerungen. Deshalb ist der Diafilm ein guter Film für Anfänger, die dann wegen des geringeren Preises mit dem Filmmaterial zu Übungszwecken nicht sparen müssen. Der günstigere Preis soll natürlich nicht dazu führen, daß man ziellos drauflosknipst!
Man muß auch nicht unbedingt Filme unterschiedlicher Empfindlichkeiten oder Arten (Diafilm, Negativfilm) einer einzigen Marke verwenden. So kann einem durchaus der Diafilm mit soundsoviel ASA der Marke X zusagen, aber bei einer anderen ASA-Zahl bzw. bei Negativfilmen zieht man die Marke Y vor.
Eine Ausnahme sind Bildserien, z.B. Diashows, bei denen ein ständiger Wechsel des Farbcharakters für den Betrachter störend wirken könnte. Hier sollte man Filme des gleichen Herstellers, der gleichen Empfindlichkeit sowie der gleichen Emulsionsnummer verwenden, die auf der Filmverpackung steht. Filme mit gleicher Emulsionsnummer besitzen die gleiche Emulsion, haben also die gleichen Eigenschaften, z.B. gleiche Farbwiedergabe und Filmempfindlichkeit.
Daß man beim Kauf von Mehrfachfilmpackungen, z.B. mit 5 oder 10 Filmen, in der Regel Geld spart, ist klar. Wenn man viel fotografiert und selbst entwickelt, gibt es aber noch eine Möglichkeit, Filme sehr günstig zu erwerben: Einige Dia- und Negativ- Kleinbild- sowie Rollfilme werden auch als Meterware in lichtdichten Dosen angeboten. Dabei befinden sich je nach Fabrikat in einer Dose 10, 15, 17, 30.5 oder 45.7 Meter Film an einem Stück. Für einen Kleinbildfilm mit 36 Aufnahmen braucht man etwa 1,70 Meter Film.
Der Kleinbild-Meterwarenfilm wird entweder von Hand oder durch ein Einspulgerät mit Bildzählwerk in lichtdichte Leer-Filmpatronen aufgerollt und dann vom Rest abgeschnitten. Leerpatronen können natürlich mehrfach verwendet werden. Man spart nicht nur gemessen am Einzelbildpreis, sondern kann sich Filme mit beliebig kleiner Aufnahmezahl herstellen. Dabei verschwendet man kein Filmmaterial, wenn man z.B. nur 6 Bilder fotografieren will. Im Handel werden Filme mit mindestens 12 Aufnahmen angeboten. Üblicherweise gibt es neben der Aufnahmezahl von 12 auch noch Filme mit 24 oder 36 Bildern. Abweichend davon bietet Agfa Farbfilme mit 15 oder 27 statt 12 oder 24 Aufnahmen an, Ilford Schwarzweißfilme mit 20 anstelle von 24.
4.7 Der DX-Code
1983 wurde von Kodak der DX-Code, ein `Informationssystem' für Filme eingeführt. Er umfaßt:
Schachbrettcode auf der Filmpatrone
Strich- und Zahlencode auf der Filmpatrone
Informationsfeld auf der Filmpatrone
Strichcode am Filmrand bei Farbnegativfilmen
Kameras der neuen Generation haben im Aufnahmefach für die Filmpatrone Kontakte, mit denen sie Informationen vom Schachbrettcode auf der Filmpatrone ablesen. Der Code besteht aus 12 Feldern, die entweder schwarz oder silbern sind. Ein schwarzes Feld ist nichtleitend für Strom und stellt die Zahl 0 dar, ein silbernes Feld leitet Strom und stellt die Zahl 1 dar. Somit lassen sich durch Nullen und Einsen binär Informationen verschlüsseln. Der Schachbrettcode teilt der Kamera Filmempfindlichkeit, Filmlänge (Bildanzahl) und Belichtungsspielraum mit. Im Anhang des Buches befindet sich eine Aufschlüsselung des Schachbrettcodes.
Der Vorteil für den Fotografen besteht darin, daß er dank DX-Code keine Filmempfindlichkeit mehr einstellen muß. Moderne Kameras erledigen das automatisch. Dadurch werden Fehlbelichtungen aufgrund einer falsch eingestellten ASA-Zahl verhindert.
Die Kamera muß über eine ausreichende Anzahl von Kontakten verfügen, um alle Informationen des Schachbrettcodes lesen zu können. Insbesondere Kleinbildsucherkameras besitzen manchmal nur wenige Kontakte. Sie können dann lediglich Filmempfindlichkeiten innerhalb eines geringen Bereiches und meist auch nur in 3-DIN-Schritten einlesen.
Der Strichcode auf der Filmpatrone ermöglicht den Kopieranstalten das automatische Sortieren der Filme für die Verarbeitung, indem er Filmtyp und Filmlänge bekanntgibt. Durch den Zahlencode sind Herstellungsland, Hersteller, Filmtyp, Empfindlichkeit, Filmlänge und Verarbeitungsprozeß eindeutig definiert.

Abbildung
4.16: DX-Code. 1=Strichcode: Verarbeitungsinformationen für
Kopieranstalten (Prozeß, Filmsorte, Filmempfindlichkeit, Filmlänge). 2=Schachbrettcode
für Kamerasteuerung (Filmempfindlichkeit, Filmlänge, Belichtungsspielraum)
3=Informationsfeld für Kamerasichtfenster (Filmsorte, Empfindlichkeit, Anzahl
der Aufnahmen) 4=Strichcode am Filmrand für Kopieranstalten (Produkterkennung,
z.B. Agfacolor XRS 100)
Ein weiteres Hilfsmittel für den Fotografen ist das Informationsfeld auf der Filmpatrone. In modernen Kameras befindet sich auf der Rückwand ein Sichtfenster (s. Abbildung 4.16), durch das man die Informationen ablesen kann. Der Fotograf kann so durch einen Blick auf das Sichtfenster Filmsorte, Empfindlichkeit und Anzahl der Aufnahmen festzustellen. Bei älteren Kameras muß zu diesem Zweck der Deckel von der Filmverpackung abgerissen und in einen Memohalter auf der Kamerarückwand gesteckt werden. Außer dem Vorteil, daß der Fotograf sich diese Prozedur erspart, erkennt er durch das Film-Sichtfenster der Kamera sofort, ob sich ein Film in der Kamera befindet oder nicht.
Der lichtsignierte Strichcode am Filmrand unterhalb der Perforation ermöglicht den Kopieranstalten die automatische Produkterkennung. Er wird erst nach der Entwicklung sichtbar. Unterschiedliche Markenfilme oder verschiedene Filme vom gleichen Hersteller können eine andere Maskierung haben. Um dann optimale Farbbilder auf gleiches Fotopapier vergrößern zu können, muß die Farbfilterung des Vergrößerers geändert werden. Mit Hilfe des Strichcodes kann das automatisch erfolgen.
4.8 Lagerung und Haltbarkeit von Filmen
Die Farbstoffe von Farbbildern und Farbfilmen bleichen mit der Zeit aus. Die Fotos werden blasser und bekommen einen Farbstich. Schwarzweißfilme sind sehr lange haltbar, wenn sie sachgemäß entwickelt wurden. Altere Farbmaterialien hatten bereits nach 20 bis 25 Jahren einen deutlichen Farbstich. Heute sind sie bei richtiger Lagerung nach Angaben der Fotoindustrie 50 bis 100 Jahre ohne erkennbare Qualitätsverluste haltbar.
Auf jeder Filmverpackung ist ein Garantiedatum aufgedruckt. Es besagt, wie lange der Film unbelichtet einwandfreie Qualität aufweist. Die angegebene Lagertemperatur, die meist um 20 C liegt, darf nicht überschritten werden. Je höher sie ist, desto schneller verliert der Film seine garantierten Eigenschaften. Deshalb sollte man Filme keinesfalls länger höheren Temperaturen aussetzen. Profis, die in Tropengebiete reisen, wickeln ihre Filme z.B. in Handtücher ein oder bewahren sie in Kühltaschen auf.
Am längsten sind Filme bei niedrigen Temperaturen haltbar. Wenn sie im Kühlschrank oder in der Kühltruhe gelagert werden, sind sie noch lange nach dem Garantiedatum ohne Qualitätsverluste einsetzbar und zwar um so länger, je niedriger die Temperatur ist. Nach einer Kaltlagerung sollte man die Filme an die Raumtemperatur anpassen, indem man sie für eine oder mehrere Stunden im Zimmer stehenläßt, bevor man sie in die Kamera einlegt.
Wenn man bereits einige Bilder fotografiert hat, der Film also belichtet ist, sollte er möglichst bald entwickelt werden, spätestens nach 4 Wochen. Denn das latente Bild ist wesentlich kürzer haltbar als ein unbelichteter Film.
Bei zu langer Lagerung verliert der Film an Empfindlichkeit. Die Bilder sind dann unterbelichtet, d.h. zu dunkel. Bei Farbfilmen kann zudem noch ein Farbstich auftreten, weil die einzelnen Farbschichten unterschiedlich auf die lange Lagerung reagieren.
Feuchtigkeit beeinträchtigt die Haltbarkeit von Filmen negativ. Originalverpackte Filme sind gut dagegen geschützt. Befindet sich der Film in der Kamera, muß man diese vor allem in Gegenden mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. in den Tropen, gut schützen. Am besten wird sie in einen wasserdichten Behälter verstaut. Das kann ein wasserdichter Fotokoffer oder auch einfach ein Kunststoffbeutel sein. Diesem gibt man ein feuchtigkeitsentziehendes Mittel wie Silikagel bei, das durch Chemikalienhandlungen bezogen werden kann.
Weil Silikagel nach einiger Zeit selbst feucht wird, erhitzt man es in diesem Falle auf 150-200 C im Backofen, je nach Menge für 1/2 bis 3 Stunden. Die Abkühlung muß in einem dicht schließenden Metallbehälter erfolgen.
Die Lagerung belichteter Filme sollte bei einer relativen Luftfeuchtigkeit um 40 % erfolgen. Die relative Luftfeuchtigkeit kann durch ein Hygrometer ermittelt werden, das jedoch relativ teuer ist. Preiswerter sind Feuchtigkeits-Indikatorstreifen. Bei einer Langzeitlagerung ist die Verwendung von Silikagel als Feuchtigkeitsschutz nicht empfehlenswert.
Auch schädigende Gase verkürzen die Lebensdauer der Filme. Sie können aus imprägnierten Hölzern, Lacken, Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Kosmetikprodukten und Schädlingsbekämpfungsmitteln austreten.
Licht bleicht die Farbstoffe des Films aus. Deshalb sollten Dias nicht länger als etwa 60 Sekunden projiziert werden, zumal Diaprojektoren auch Hitze erzeugen. In glaslosen Rahmen sind Dias länger haltbar. Die Diarahmung wird später noch einmal ausführlicher behandelt.
Wenn die Filme von Pilzen oder Bakterien befallen sind, lassen sich die bereits entstandenen Schäden nicht mehr beheben. Man kann jedoch deren weitere Ausbreitung stoppen. Dazu wird der Film in einer Lösung von 1 g 2-Phenylphenol-Natrium in einem Liter Wasser drei Minuten gebadet. Anschließend wird er 3-5 Sekunden mit Wasser abgespült und vor der Lufttrocknung in ein Netzmittelbad (Laborbedarf) getaucht.
Zusammenfassend kann man zur richtigen Lagerung von Filmen sagen, daß sie kühl, chemisch neutral, dunkel und bei geringer Luftfeuchtigkeit um 40 % aufbewahrt werden sollen.
Abschließende Praxistips
Zum Abschluß dieses Kapitels sollen noch einige Praxistips gegeben werden. Zum Teil handelt es sich um Wiederholungen, aber auch um Vorgriffe auf die Kapitel Objektive und Verschluß. Doch die Tips sind für die Praxis so wichtig, daß sie an dieser Stelle zusammengefaßt werden sollen.
Auf jede Filmverpackung ist die Empfindlichkeit aufgedruckt. Normalerweise stellt der Fotograf diesen Wert an der Kamera oder am Handbelichtungsmesser ein. Nun ist es möglich, daß die Kameraverschlußzeiten vom Sollwert abweichen. Zudem sind bei der Filmproduktion Schwankungen möglich. Während das bei Negativfilmen praktisch keine Rolle spielt, können Diafilme zu hell oder zu dunkel ausfallen. Letztlich spielt auch der persönliche Geschmack eine Rolle. So belichten manche Fotografen Diafilme generell um ein bis zwei ASA-Schritte knapper oder reichlicher, als von den Herstellern empfohlen wird. Unter einen ASA-Schritt ist dasselbe zu verstehen wie eine Veränderung der Filmempfindlichkeit um
1 DIN.
Eine knappere Belichtung erhält man durch die Einstellung einer höheren ASA-Zahl, indem man z.B. 125 oder 160 ASA statt 100 ASA einstellt. Dadurch erscheinen die Farben etwas kräftiger. Stellt man eine niedrigere ASA-Zahl ein, fällt die Belichtung reichlicher aus und die Farben sind weniger kräftig. Diafilme werden in der Regel besser zu knapp als zu reichlich belichtet.
Wer bei der Empfindlichkeitseinstellung ganz sicher gehen will, kann einen Test vornehmen. Dazu sucht man sich ein farbiges Motiv aus, beispielsweise eine mit unterschiedlichen Früchten gefüllte Obstschale, das möglichst gleichmäßig und schattenfrei beleuchtet wird. Man fotografiert nun eine Serie, wobei ein Bild genau nach Herstellerangabe belichtet wird, die restlichen dann jeweils um einen ASA-Schritt knapper sowie reichlicher, bis zur halben/doppelten ASA-Zahl. Einen 100 ASA-Film belichtet man zuerst wie 100 ASA, dann wie 125, 160 und 200 ASA, gefolgt von 80, 64 und 50 ASA. Nach normaler Entwicklung wird für zukünftige Belichtungen die ASA-Zahl zugrunde gelegt, die den besten Eindruck hinterläßt.
Hier ist der persönliche Geschmack entscheidend. Allerdings ist der Test nur dann sinnvoll, wenn sämtliche Kameraverschlußzeiten genau abgestuft sind und man Filme mit gleicher Emulsionsnummer verwendet. Mit der genauen Abstufung der Verschlußzeiten ist gemeint, daß sie zwar ungenau sein dürfen, aber alle um den gleichen Faktor. So darf sich der Verschluß bei der Einstellung von 1/500 Sekunde nur 1/333 Sekunde öffnen. Dann müssen aber auch alle anderen Zeiten um den Faktor 1,5 nachgehen, die Einstellung von 1/15 Sekunde also nur 1/10 belichten.
Um Filme auch nach dem Verfalldatum verwenden zu können, lagert man sie in Kühlschränken oder noch besser in Gefriertruhen. Bevor man kaltgelagerte Filme in die Kamera einlegt, müssen sie erst für eine oder mehrere Stunden an die Umgebungstemperatur angepaßt werden. Je niedriger die Lagertemperatur war, desto länger muß man sie im Zimmer stehen lassen. Allerdings lohnt sich die Kühlschranklagerung von Amateurfilmen nur für Schwarzweißfilme oder Filme, die von den Herstellern über längere Zeit nicht verändert werden. Die meisten Farbnegativ- oder Farbdiafilme werden alle ein bis zwei Jahre verbessert. So lange kann man sie auch bei Zimmertemperatur lagern. Manchmal wird ein Film verbessert, ohne daß der Hersteller das bekanntgibt. Man erwirbt dann einen Film mit gleichen Namen in gleicher Verpackung, der aber andere Eigenschaften besitzen kann.
Die Frage nach der richtigen Empfindlichkeit kann generell mit `so niedrig wie möglich, aber so hoch wie nötig' beantwortet werden. Wenn man Landschafts- oder Architekturaufnahmen fotografiert, sollte man 25 ASA oder 50 ASA-Filme einsetzen und das Stativ nicht vergessen. Auf Reisen ist der 100 ASA-Film ein guter Begleiter, aber auch einige 400 ASA oder gar noch höherempfindliche Filme ermöglichen ungewöhnliche Aufnahmen, z.B. im Theater oder Kneipen bei Originalbeleuchtung.
Wenn man aus freier Hand fotografiert, entscheidet auch die Brennweite des Objektives über die richtige Filmempfindlichkeit. Die Verschlußzeit in Sekunden sollte nicht unterhalb des Kehrwertes der Brennweite in Millimetern liegen.
Bei einen 500 mm-Objektiv sollte die Verschlußzeit höchstens 1/500 Sekunde betragen oder noch kürzer sein, bei einen 50 mm-Objektiv höchstens 1/60 Sekunde. Wenn Zoomobjektive verwendet werden, ist die längste Brennweite ausschlaggebend. So wählt man bei einen 75-300 mm-Objektiv vorsichtshalber 1/500 Sekunde, also die nächstliegende kürzere Zeit zu 1/300 Sekunde, denn die läßt sich bei den für alle Kameras genormten Verschlußzeitenabstufungen normalerweise nicht einstellen.
Die Kehrwertregel ist nur eine Faustregel. Natürlich ist die längste Verschlußzeit, die man mit einer bestimmten Brennweite `halten' kann, von Mensch zu Mensch verschieden und hängt auch vom momentanen Zustand ab (z.B. müde). Wer jedoch behauptet, mit einem Telebjektiv großer Brennweite auch noch bei verdächtig langen Zeiten freihändig scharfe Aufnahmen zustandezubringen, der soll mit behaupteter Zeit eine Zeitungsseite fotografieren -- einmal freihändig und einmal mit Stativ. Jede Wette: Wenn er anschließend das Ergebnis mit einer hochwertigen Lupe (das sind Lupen, die um 300 DM kosten) betrachtet, nimmt er seine Aussage zurück.
Bevor man einen Film auswählt, setzt man das Objektiv an das Kameragehäuse und mißt bei offener Blende die Verschlußzeit. Ist diese nicht kurz genug, verstellt man die ASA-Zahl solange, bis das der Fall ist und wählt dementsprechend den Film aus. Bei wechselhaften Licht, wenn die Sonne sich z.B. öfter einmal hinter den Wolken versteckt oder wenn man durch helle und dunkle Straßenzüge zieht, muß eine verwacklungssichere Verschlußzeit auch bei geringerer Beleuchtungsstärke erreicht werden.
Benötigt man einen höherempfindlichen Film, hat aber keinen zur Hand, kann man einen niedrigempfindlicheren wie einen höherempfindlichen belichten. Stellt man z.B. fest, daß die für ein verwacklungsfreies Fotografieren notwendige Verschlußzeit nur mit einen 200 ASA-Film erreicht werden kann, aber man hat nur 100 ASA-Filme, so verwendet man einen 100 ASA-Film, stellt aber 200 ASA an der Kamera oder am Handbelichtungsmesser ein. Dabei muß der ganze Film wie 200 ASA belichtet werden. Anschließend wird der Film gut gekennzeichnet, z.B. mit einen roten Aufkleber, auf dem die normale und die belichtete ASA-Zahl steht. Das Fotolabor muß extra darauf hingewiesen werden, damit es eine Sonderentwicklung vornimmt. Man stellt immer die doppelte oder vierfache ASA-Zahl ein.
Dieser Vorgang wird auch als Pushen bezeichnet. Je weniger man den Film pusht, desto besser fallen die Ergebnisse aus. Am besten sind die Resultate natürlich dann, wenn man den Film genau nach Herstellerangabe belichtet. Es ist aber auch möglich, wenngleich wenig sinnvoll, einen höher empfindlichen Film wie einen niedriger empfindlichen zu belichten. Im Eifer des Gefechts habe ich einmal versehentlich einen 200 ASA-Diafilm wie 100 ASA belichtet. Für das Labor war es kein Problem, den Film entsprechend zu entwickeln. Allerdings war die Bildqualität nicht mit einem 100 ASA-Film, sondern mit der eines 200 ASA-Films vergleichbar.
Es kann schon einmal vorkommen, daß man einen Film noch nicht vollständig belichtet hat, aber nun mit einen höher- oder niedrigempfindlicheren Film oder einem Schwarzweißfilm statt des Farbfilms fotografieren will oder muß. Das ist kein Problem wenn man über ein zweites Kameragehäuse verfügt. Wenn das nicht der Fall ist, kann man den alten Film in der Kamera zurückspulen und den neuen einlegen. Was geschieht mit den restlichen Aufnahmen des alten Films? Man kann sie ohne größere Umstände noch ausnutzen, wenn man den Film nicht ganz in die Patrone zurückgespult hat. Nach der Rückspulung notiert man zuerst einmal die vorläufige Aufnahmezahl, am besten auf der Filmpatrone.
Wenn man den Film wieder in die Kamera einlegt, setzt man den schwarzen, lichtundurchlässigen Schutzdeckel vor das Objektiv und stellt dort die kleinste Blende, das ist die größte Zahl, ein. Am Kameraverschluß wird die kürzeste Zeit gewählt und anschließend Bild für Bild fotografiert, bis man um zwei Bilder weiter ist, als sich bereits Aufnahmen auf dem Film befinden. Weil durch den Objektivdeckel kein Licht fällt, werden die ursprünglichen Bilder nicht ein zweites Mal ungewollt belichtet. Die Sicherheitszugabe von einer Aufnahme ist notwendig, damit sich an der `Nahtstelle' die Bilder nicht überlappen. Hat man also bereits 18 Aufnahmen fotografiert, so wird der Film bis Bild Nr. 20 transportiert.
Spult man von Hand über eine Kurbel zurück, fühlt man ein plötzliches Nachlassen des Widerstandes, wenn sich der Film von der Aufwickelspule der Kamera gelöst hat. Dann kann man die Rückwand öffnen und ist sicher, daß der Filmanfang nicht in der Patrone verschwunden ist. Nun gibt es Motorkameras, die den Film ganz in die Patrone zurückspulen. In diesem Fall hilft ein Filmherauszieher von der Firma hama, mit dem man den Filmanfang wieder aus der Filmpatrone zurückholen kann. Bei vollautomatischen Kompaktkameras ist es normalerweise nicht möglich, Blende und Verschlußzeit vorzuwählen und einen lichtdichten Deckel aufzusetzen. Hier kann man in einem lichtdichten Raum, z.B. im abgedunkelten Zimmer unter einer dicken Bettdecke, den Film Bild für Bild vortransportieren. Dazu muß der Automatikblitz abgestellt werden!
Manchmal möchte man auch einen teilbelichteten Film entwickeln, wenn z.B. von den 36 Aufnahmen nur 18 fotografiert wurden und man den unbelichteten Rest zu einen späteren Zeitpunkt weiterverwenden will. Oder man hat die ersten Aufnahmen mit einer anderen Empfindlichkeit belichtet. Ein schlimmerer Fall wäre, wenn der Film plötzlich reißt. Was wird dann aus den bereits belichteten Filmstück?
Auch hier benötigt man einen lichtdichten Raum, z.B. unter der Bettdecke im abgedunklten Schlafzimmer. Noch professioneller ist ein Film-Wechselsack, der aber für gelegentliche Anwendungen zu teuer ist. Im Dunkeln öffnet man die Kamerarückwand und entnimmt den teilbelichteten Film. Bei Kameras ohne motorischen Rücktransport muß man dazu den Rückspulentsperrknopf drücken. Ist der Film nicht abgerissen, schneidet man ihn mit der Schere an der Stelle, kurz nachdem er aus der Patrone kommt, senkrecht ab. Dann rollt man ihn auf und verstaut ihn in einer schwarzen, lichtdichten Filmdose.
Wird der Film nicht selbst entwickelt, klebt man den Dosendeckel zum Schutz gegen versehentliches Öffnen am besten mit Klebeband zu und fordert eine Spezialentwicklung an. Dazu müssen der genaue Filmtyp und die Empfindlichkeit angegeben werden. Den restlichen Film zieht man zur weiteren Verwendung ein Stück aus der Filmpatrone und schneidet den Anfang am besten nach den Muster eines neuen Films zu. Dieses Verfahren eignet sich natürlich nicht für Kameras, die zuerst den ganzen Film aus der Patrone ziehen, und dann Aufnahme für Aufnahme in die Patrone zurückziehen. Im Falle eines Filmrisses ist man hier besser dran, denn der belichtete Film befindet sich bereits in der Patrone. Allerdings ist es nicht möglich, einen teilbelichteten Film zu entnehmen und den Rest später wiederzuverwenden, denn der muß sich ja lichtgeschützt in einer Patrone befinden, die bereits für die belichteten Bilder reserviert ist.
5 Elektronische Bildverarbeitung
Bei der elektronischen Bildverarbeitung werden digitalisierte Fotos und natürlich auch beliebige andere digitale Bilder mit einem Computer verarbeitet. Zukünftig wird die elektronische Bildverarbeitung sicherlich eine noch größere Bedeutung als gegenwärtig erlangen. Zwei Systeme, die in praktisch jedes Fachgeschäft Einzug gehalten haben und auf elektronischer Bildverarbeitung basieren, sind die Kodak Photo CD und das Agfa Digital Print System.
Eine verständliche Beschreibung der elektronischen Bildverarbbeitung würde ein ganzes Buch füllen. Deshalb wird hier darauf verzichtet. Das Agfa Digital Print System und die Photo CD sind jedoch für den einen oder anderen `normalen' Fotografen sicherlich von Interesse. Deshalb werden sie hier kurz beleuchtet. Wenn der eine oder andere Fachbegriff aus der Computertechnik, wie z.B. `Speicher' oder `Schnittstelle' usw. auftaucht, ist er hier nicht erklärt, weil das den Rahmen des Buches sprengen würde. Dafür ist ebenfalls zahlreiche Literatur erhältlich.
Ein digitaler Computer kennt nur zwei Zustände: `Ein' oder `Aus'. Anstelle von Ein oder Aus werden häufig auch die Bezeichnungen `High' oder `Low', bzw. 1 (Eins) oder 0 (Null) verwendet. Die Fotos müssen erst in eine Folge aus Einsen und Nullen umgewandelt werden, bevor der Computer sie verarbeiten kann. Diesen Vorgang nennt man digitalisieren. Digitale Kameras erzeugen ohne Umwege digitale Bilder. Momentan sind digitale Kameras jedoch wegen zu schlechter Auflösung (Bildschärfe) oder zu hohen Preises keine Konkurrenz für die `herkömmlichen' Apparate. Deshalb nutzen das Agfa Digital Print System und die Kodak Photo CD noch den Umweg über ein auf herkömmliche Weise entstandenes Dia bzw. Negativ, welches zuerst digitalisiert werden muß, bevor es der Computer verarbeiten kann.
Das Digitalisieren der Negative und Dias geschieht durch einen Scanner. Im Scanner befinden sich lichtempfindliche Sensoren, die zeilenförmig nebeneinander angeordnet sind. Je zahlreicher diese Sensoren sind, desto höher ist die Auflösung eines Bildes. Negativ oder Dia werden durchleuchtet und mit den Sensoren zeilenweise abgetastet. Aus der Anzahl der Sensoren einer Zeile mal Anzahl der abgetasteten Zeilen ergibt sich die Anzahl der Bildpunkte bzw. die Auflösung des Bildes. Mit zunehmender Auflösung wächst die Bildschärfe. Farbfotos müssen jeweils mit einer der drei additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau gescannt werden. Hier wird nicht näher auf die Scannertechnik und Analog-Digitalwandlung eingegangen. Interessierte Leser finden sicherlich geeignete Literatur unter den zahlreichen Computerfachbüchern.
Zum Abschluß der Kapiteleinleitung möchte ich anmerken, daß die elektronische Bildverarbeitung das `normale' Fotolabor noch nicht ablösen wird, sondern nur eine Ergänzung darstellt. Eine Ablösung ist erst dann in Aussicht, wenn der Umweg über Negative bzw. Dias nicht mehr notwendig ist, um Qualitätsbilder zu erhalten. Dazu müssen Funktionalität, Qualität und Preis von Digitalkameras und Verarbeitungsanlagen mit `konventionellen' Kameras und Fotolabors vergleichbar sein.
5.1 Das Agfa Digital Print System
Besondere Möglichkeiten des Agfa Digital Print System
5.1 Das Agfa Digital Print System
Das Agfa Digital Print System ist eine Alternative, um Papierbilder vom Dia zu erhalten. Üblicherweise bieten Fotofachgeschäfte ihren Kunden diesen Service an. Mometan können damit Vergrößerungen im Format von 9x13 cm bis zu 20x30 cm hergestellt werden. Das Agfa Digital Print System eignet sich besonders für kontrastreiche und fehlbelichtete Dias.
Diafilme haben eine steilere Gradation und höheren Kontrastumfang als Negativfilme. Dadurch erscheinen sie in der Projektion brillanter. Fotopapier, welches nicht durchleuchtet, sondern von oben beleuchtet wird, weist generell einen geringeren Kontrastumfang als Diafilme auf. Deshalb kann es Dias mit starken Kontrast nicht vollständig wiedergeben. Relativ dunkle Diastellen mit Zeichnung erscheinen dann auf dem Papier schwarz und helle Stellen weiß. Ein weiterer Nachteil der herkömmlichen Diavergrößerung besteht darin, daß sich unter- und überbelichtete Dias meist nur unzufriedenstellend vergrößeren lassen. Dem Papierbild fehlen dann Detailzeichnung, Farbsättigung und Kontrast. Diese Mängel kann das Agfa Digital Print System teilweise beheben. Wunder darf man allerdings nicht erwarten: Was auf dem Dia nicht zu erkennen ist, wird auch auf dem Print nicht zu sehen sein.
Prinzipielle Arbeitsschritte:
scannen und Digitalisieren des Dias
ablegen des digitalisierten Bildes im Bildspeicher
Veränderung durch Bildprozessor automatisch oder manuell
elektronische Bildumkehrung
Belichtung mit Kathodenstrahlröhre und Optik auf normales Farbnegativpapier
Zuerst wird das Dia in die sogenannte Slide Scan Unit (S.S.U.) eingelegt und durch einen CCD-Scanner mit einer Auflösung von 2048 x 1024 Bildpunkten abgetastet. Dabei wird das Dia dreimal, jeweils mit einer der additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau durchleuchtet. Pro Bild entstehen so drei unterschiedliche Farbauszüge. Belichtung und Weißabgleich erfolgen automatisch.
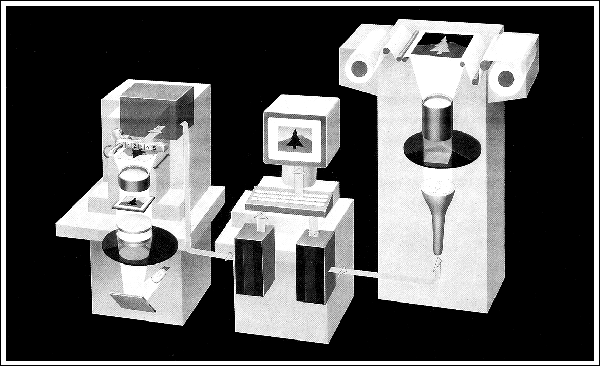
Die drei
digitalisierten Bilder werden in einem Speicher abgelegt. Von dort werden sie
gleichzeitig ausgelesen und durchlaufen die Bildverarbeitungseinheit (Digital
Image Processor: D.I.P.). Das Ergebnis der Bildverarbeitung läßt sich auf einem
Bildschirm kontrollieren. Über ein Tastenfeld sind Anderungen möglich, z.B. um
Korrekturen vorzunehmen. Bildschirm und Belichtungseinheit (Druck; Cathode Ray
Tube Printer: C.R.T. Printer) sind weitgehend aufeinander abgestimmt, so daß
Monitorbild und Papierbild praktisch übereinstimmen. Nach der elektronischen
Verarbeitung wird das Bild in einen Speicher ein- und von dort in den C.R.T.
Printer seriell ausgelesen. Die Farbauszüge werden dabei invertiert, so daß
drei Schwarzweiß-Negative entstehen.
Abbildung 5.1: Agfa Digital Print System. Links ist die Slide Scan Unit zu erkennen. Eine Lampe beleuchtet einen Spiegel, der das Licht über ein Interferenzfilter durch das Dia schickt. Das Interferenzfilter sorgt dafür, daß pro Scanvorgang eine der drei additiven Grundfarben das Dia durchleuchtet. Ein Objektiv projiziert das Dia auf einen CCD-Scanner, der das Bild zeilenweise abtastet und digitalisiert. Die drei unterschiedlichen Farbauszüge werden in einem Bildspeicher abgelegt (Mitte). Die Bildverarbeitungseinheit, welche in der Mitte zu sehen ist (Digital Image Processor), liest das Bild aus und zeigt es auf einem Bildschirm an. Über das Tastenfeld können Korrekturen vorgenommen werden. Das Verarbeitungsergebnis wird in einem weiteren Speicher abgelegt und durch den C.R.T. Printer (rechts) ausgelesen. Eine Kathodenstrahlröhre (rechts unten) projiziert das umgekehrte (Negativ-) Bild durch ein Interferenzfilter auf ein Objektiv und dieses belichtet das Fotopapier, welches sich in Tageslichtkassetten befindet (rechts oben).Der C.R.T. Printer besteht aus einer Kathodenstrahlröhre, einem Interferenzfilter und einem Objektiv. Ein bekanntes Beispiel für eine Kathodenstrahlröhre ist der Fernsehapparat. Der Bildschirm des C.R.T. Printer hat jedoch eine weit höhere Auflösung und ist nicht gewölbt, also flach. Das Interferenzfilter sorgt dafür, daß für jedes der drei Negative Licht in einer der drei additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau zur Belichtung des Fotopapiers zum Objektiv gelangt. Die Belichtung erfolgt also seriell in 3 Schritten. Das Objektiv projiziert das Monitorbild auf das Fotopapier, welches sich in Tageslichtkassetten befindet.
Besondere Möglichkeiten des Agfa Digital Print System
Besondere Möglichkeiten des Agfa Digital Print System
Prinzipiell können durch das Agfa Digital Print System alle Möglichkeiten einer elektronischen Bildverarbeitung genutzt werden.
Besonders hervorzuheben sind:
Die Farbsättigung kann unabhängig vom Kontrast geändert werden. Bei normalen Vergrößerungen steigert sich mit der Farbsättigung auch der Kontrast. Dabei können feine Farbunterschiede und Motivdetails verlorengehen.
Auch von alten, farbstichigen Dias können noch gute Papierbilder abgezogen werden.
Unter- und überbelichtete Dias werden durch das Agfa Digital Print System besser wiedergegeben als auf konventionellem Wege.
Die Gradation kann in Lichtern und Schatten unterschiedlich beeinflußt werden. Dadurch erhöht sich der Detailreichtum insbesondere bei kontrastreichen Dias.
Nebendichten lassen sich berücksichtigen. Während man bei Negativfilmen eine Korrektur einbauen kann (siehe `Maskierung'), ist dies bei Diafilmen nicht möglich.
Die Bildverarbeitung ermöglicht eine automatische Schärfeverbesserung, die in den Details eine höhere visuelle Schärfe erzeugt.
Von Farbdias können auf einfache Weise Schwarzweißbilder hergestellt und auf Farbpapier vergrößert werden.
Von Schwarzweißdias lassen sich farbstichfreie Vergrößerungen auf Farbnegativpapier vergrößern.
Das Bild kann verfremdet werden.
Über eine optionale Schnittstelle (Digital Image Interface: DII) können Bilder von digital gespeicherten Vorlagen, z.B. Photo CD, Still Video, am PC gefertigte Daten preiswert auf Negativpapier belichtet werden. Die Daten müssen nur im Standard-RGB-TIFF-Format vorliegen.
Zukünftig wird das Agfa Digital Print System vielleicht noch um einige Features erweitert:
Abzüge auch von anderen Filmformaten als Kleinbild
Bilder von Aufsichtsvorlagen, z.B. `Bild vom Bild'
Speicherung auf anderen physikalischen Trägern, elektronischen Bildspeichern, Platten- oder Bandlaufwerken
Zum Schluß noch einige Anmerkungen: Die eingescannte Auflösung von 1024 x 2048 Punkten liegt noch unterhalb der maximal möglichen Auflösung eines Kleinbilddias. Außerdem ist die Gesamtauflösung durch die Kathodenstrahlröhre des C.R.T. Printer begrenzt. Deshalb werden auch keine größeren Bildformate als 20 x 30 cm angeboten. Hier könnte sich zukünftig noch einiges ändern.
Das Agfa Digital Print System eignet sich besonders für Vergrößerungen von kontrastreichen Dias. Darin ist es dem herkömmlichen Verfahren überlegen, bei dem das Dia durch einen Vergrößerer auf Umkehr-Fotopapier projiziert wird. Das wirkliche - d.h. nicht das mögliche - Resultat hängt von der elektronischen Bildverarbeitung ab und davon, ob eine Person korrigierend eingreift. In der Mehrzahl aller Fälle wird die Bedienperson des Agfa Digital Print System wohl nicht in die automatische Bildverarbeitung eingreifen, denn sonst rechnet sich die Anlage nicht - es sei denn man verlangt entsprechend hohe Preise für einen Abzug. Das heißt, im Normalfall läuft die Verarbeitung vollautomatisch, ohne Eingriffe durch die Bedienperson ab. Deshalb ist es durchaus sinnvoll, nicht so gelungene Vergrößerungen erneut zum Nachbessern einzureichen.
Literaturverzeichnis
Agfa-Gevaert (Hrsg.): Fototechnische Informationen, Leverkusen.
Agfa-Gevaert (Hrsg.): Expertenspiel, Expertenclub, Leverkusen.
Anderson, John R.: Kognitive Psychologie, 2. Auflage, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1989.
Adams, Ansel: Die Kamera, 6. Auflage, München: Christian Verlag, 1992.
Feininger, Andreas: Die hohe Schule der Fotografie, 9. Auflage, München: Heyne Verlag, 1986.
Hammer, Karl: Grundkurs der Physik, Teil 2, 3. Auflage, München: Oldenbourg, 1987.
Hubel, David H.: Auge und Gehirn, Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 1989
Lurija, Alexander: Der Mann, dessen Welt in Scherben ging, Reinbek: Rowohlt, November 1992.
Oehler, Regina: Die Projektion der Wirklichkeit, in: bild der wissenschaft, August 1993, S.58-63.
Solf, Kurt Dieter: Fotografie, Frankfurt am Main: Fischer, 1990.
Teicher, Gerhard (Hrsg.): Handbuch der Fototechnik, 9. Auflage, Leipzig: VEB, 1986.
Tillmanns Urs: Geschichte der Fotografie, Stuttgart: Huber, 1981
Zeki, Semir M.: Das geistige Abbild der Welt, in: Spektrum der Wissenschaft, November 1992, S.54-63.
Haupt | Fügen Sie Referat | Kontakt | Impressum | Nutzungsbedingungen
